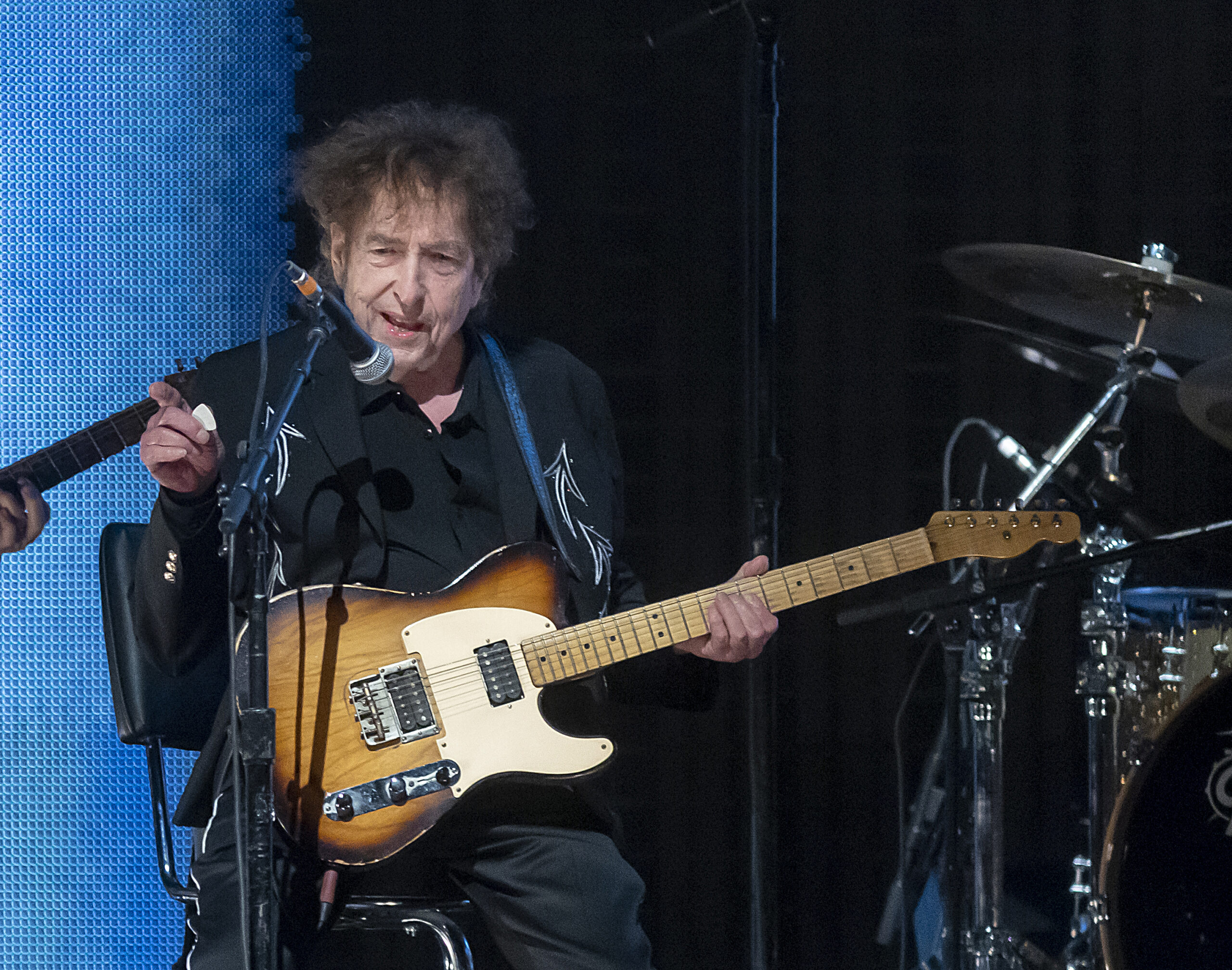Joe Henry
„Civilians“ – Amerika der Ängste
Earmusic (VÖ: 23.8.)
Drei Großwerke des Songschreibers Joe Henry mit Demos und Live-Fassungen.
Vielleicht kann man nur entweder ein beflissener Songwriter oder ein serviler Produzent sein. Aber beweist uns Joe Henry nicht das Gegenteil? Als der Sänger, dem ein angemessenes Publikum stets verwehrt geblieben ist, mit „Civilians“ (2007) seine große Americana-Erzählung vorlegte, hatte er bereits Platten von Größen wie Solomon Burke, Allen Toussaint und Elvis Costello veredelt. Nach dem kreativen Chaos von „Tiny Voices“ (2003) ereilte Henry hingegen eine gewisse schöpferische Leere mit Blick auf das eigene Werk.
Gegen die kämpfte er nun mit dem Willen zur Verdichtung und Konzentration an. Bis alles zwangsläufig beim lieben Gott und irgendwie auch bei Brian Wilson landete, ließ Henry seine Protagonisten in raffinierten Geschichten von Liebe und Verrat, von Sehnsüchten und Ängsten um ein Amerika kreisen, das sich selbst fremd geworden ist. Als Höhe- und Wendepunkt der Aufnahme gerierte sich „Our Song“, in dem der Musiker den Baseball-Nationalhelden Willie Mays in einem Baumarkt wütend in sich reinbrummeln ließ („This was my country/ This was my song/ Somewhere in the middle there/ Though it started badly and it’s ending wrong“).
„Alles wurde zu einem einzigen Impuls für mich, der direkt in meinem Keller in die Tat umgesetzt wurde“
Henry hatte die meisten Songs auf der Akustikgitarre eingespielt und später dann gemeinsam mit Gästen wie Bill Frisell, Greg Leisz und Van Dyke Parks detailreich verfeinert. Das Konzept war schlicht, die Produktion unsichtbar zu machen. Eine Band in einem Raum, die gemeinsam spielt. Die komplexen Songstrukturen wurden bei den Aufnahmen mit anschmiegsamen und dann wieder zutiefst rohen Melodien in einen ruhig dahintreibenden Fluss gebracht. Erst später fiel Henry auf, dass das Album so etwas wie der Auftakt für eine künstlerische Reifung war. Er habe damals aufgehört, die „Grenze zwischen der Komposition eines Songs und seiner Artikulation im Studio zu betrachten“, sagt er heute.
„Alles wurde zu einem einzigen Impuls für mich, der direkt in meinem Keller in die Tat umgesetzt wurde.“ Auch deshalb erscheinen nun drei seiner Platten als eine Art Triade mit allerhand Archivmaterial zum ersten Mal auf Vinyl. Sie erzählen wie selbstverständlich von der musikalischen und thematischen Bandbreite dieses Künstlers, der von Bluegrass bis New-Orleans-Jazz jedes Genre amerikanischer Musik einnehmen kann und doch stets bei sich selbst herauskommt. Sie zeigen mit ungeschliffenen Demos, wie sehr Henry an seinem Material arbeitet, bis es vielleicht nicht glänzt, aber den Punkt trifft. Für „Blood From Stars“ (2009,) trat der Sänger wieder einen Schritt zurück, ließ sich inwendig auf rhythmisch versierten, orchestral gefederten Blues mit Jazz- und Country-Tupfern ein. Unterstützt wurde Henry dabei von vielen seiner Stammmusiker, aber erst die Gäste – Marc Ribot, Jason Moran und sein Sohn Levon am Saxofon – sorgten für den Feinschliff.
Fünf auf Vinyl beigepackte „Live On Air“-Fassungen zeigen, wie akribisch der Sänger seine Lieder aufs Wesentliche zusammenziehen konnte, ohne an Tiefe einbüßen zu müssen. Es mag etwas verwundern, warum „Reverie“ (2011) übergangen wird und „Invisible Hour“ (2014,) das Triptychon abschließt. Aber womöglich geht es Henry darum, die Spontaneität eines in vier Tagen aufgenommenen und mit leichter Hand musikalisch eher sanft illustrierten als vollständig in Szene gesetzten Reigens aus Trauermärschen und Liebesliedern (Höhepunkt: „Plainspeak“, mit Gospel-Pathos und einem himmlischen Saxofon) als Endpunkt seiner Möglichkeiten vorzuführen, als Produzent auf sein eigenes Werk einwirken zu können, ohne es erstarren zu lassen.