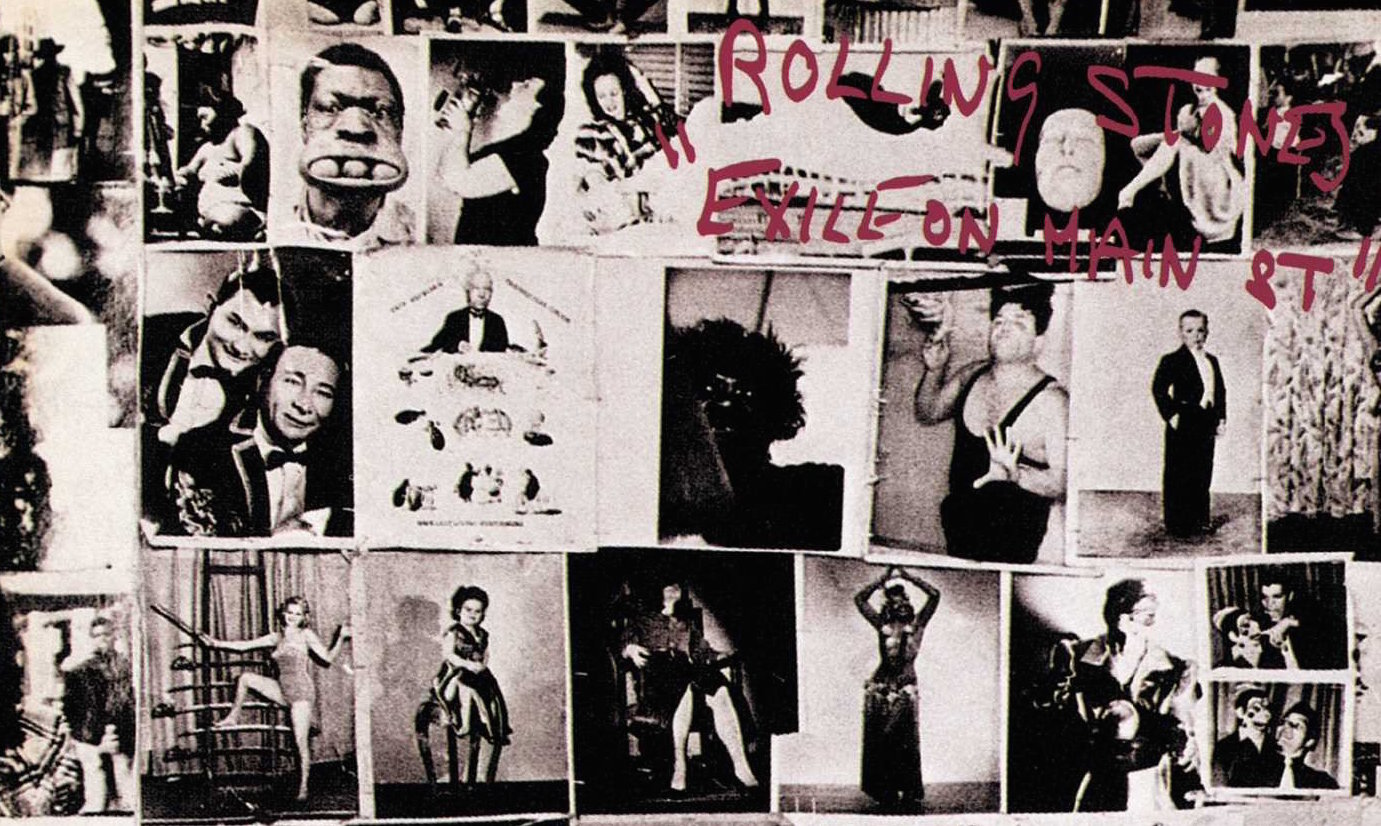Kritik: Gescheiterter „Oppenheimer“ – Ein Leben, zu groß für Nolan
Wer war J. Robert Oppenheimer? Christopher Nolan beantwortet die Frage nicht. Will er das überhaupt?

Die Geschichte, eher noch die Karriere J. Robert Oppenheimers, des „Vaters der Atombombe“ und Leiter des geheimen Manhattan-Projekts, ist eine, die man sehr spannend nachlesen kann, die aber bislang unbefriedigend auf der Leinwand erzählt wurde. Weil kaum einer die Physik versteht. Eine Physik, die so wichtig ist, dass der sie benutzende Mensch dahinter oft verschwindet. Norman Taurogs Propaganda-Debakel „The Beginning or the End“ von 1947, der erste Hiroshima-Film, steht da in einer Reihe mit Roland Joffes hübsch uniformiertem, aber belanglosen „General Groves vs. Oppenheimer“-Standoff „Der Schattenmacher“ von 1989.
Auch Christopher Nolans „Oppenheimer“ vermag die Gedankenwelt – oder eher Gefühlswelt? – des theoretischen Physikers, der die Welt des 20. Jahrhunderts bis heute mehr prägte als Albert Einstein oder Sigmund Freud, nicht zu erklären. Vielleicht will er das auch nicht. Der Regisseur ist da sehr eigen, entscheidend war für Nolan immer, dass er die Dinge, die allein er verstanden hat, für sich ins Kino bringen konnte. In seinem am schwierigsten zu verstehenden Werk, „Tenet“ von 2020, gönnt er sich den überheblichen Spaß, das „Inversions-Prinzip“ durch Kenneth Branagh ausgerechnet in jenem Moment erklären zu lassen, als der Motor seines E-Katamarans derart auf Hochtouren röhrt, dass auch Soundtrack-Komponist Ludwig „Loudness“ Göransson dagegen nicht ankommt. Und man kein Wort versteht. Auch in „Oppenheimer“ greift der schwedische Musiker auf sein Prinzip der Totalkomposition zurück und liefert sich einen Klangwettkampf mit Knall, Donner und Druckwelle.
Ereignisse aus seiner Kindheit
Bedeutsamkeit ist nicht nur positiv konnotiert, das wusste auch der vielleicht bedeutsamste Mensch des letzten Jahrhunderts. Bedeutsamkeit meint auch Tragweite. Oppenheimer zitierte aus der Baghavad Gita, der zentralen Lehrschrift des Hinduismus: „Wenn das Licht von tausend Sonnen / am Himmel plötzlich bräch’ hervor / das wäre gleich dem Glanze dieses herrlichen, und ich bin der Tod geworden, Zertrümmerer der Welten.“
Weil Christopher Nolan aber glaubt, den Zuschauern ausgerechnet hier etwas mehr bieten zu müssen als die Weiterverarbeitung von Versen in Physik, blendet er dazu nicht etwa den von schwerer Krankheit gezeichneten Oppenheimer von 1965 ein, der diese Worte – festgehalten in einem berühmt gewordenen Video – spricht, als gebrochenes Genie mit gesenktem Blick, sondern: beim Sex mit seiner Geliebten Jean (Florence Pugh). Es ist Nolans bemüht-cineastischer Versuch, die Zerrissenheit eines Mannes darzustellen, der zu spät erkennt, dass sein Schaffen zwar produktiv ist, in diesem Fall sogar Lust bereitet, dieses Schaffen aber auch missbraucht werden kann.
Jeder Nolan-Protagonist, nein, jeder gut konstruierte Film-Protagonist, in Nolans Fall zum Beispiel Batman, Cooper oder Cobb, wird von Ereignissen aus seiner Kindheit oder zumindest frühem Erwachsenenalter bestimmt. Diese (Anti-)Helden versuchen ein Trauma zu verarbeiten, in dem sie fortan möglichst vieles richtig machen. Wer J. Robert Oppenheimer war, warum er den Bau der Atombombe forcierte – war es wirklich sein Wille, schneller zu sein als die Nazis? – scheint kein dringend zu erhellendes Anliegen Nolans zu sein. Wir sehen, wie Oppenheimer als junger Student versucht seinen Lehrer mit Zyanid zu vergiften, aber den Anschlag gerade noch, als die Reue ihn übermannt, verhindern kann. Das ist etwas – immerhin. Aber es ist nicht viel.
„Das kriegen wir hin“
„Die Wissenschaft kann das Leben eines Menschen nicht wiederholen“, sagt der von Cillian Murphy gespielte Oppenheimer. Dieser Versuch wäre auch nicht gut anzusehen. Wie schon in „Interstellar“ versucht Nolan eine komplizierte Naturwissenschaft anhand praktischer Beispiele transparent zu manchen, was manchmal zu unfreiwilliger Komik führt. In seinem Weltraumdrama von 2014 legte er das Prinzip der Gravitation – entlehnt am Sci-Fi-Trash-Film „Event Horizon“ – mit jenem Bleistift dar, der das Ende eines Blatt Papiers schneller erreicht, wenn er dessen Falz durchbohrt.
In „Oppenheimer“ schwenkt der flirtende „Oppy“ ein Whiskeyglas und bezirzt seine zukünftige Ehefrau Kitty (Emily Blunt) mit einer Rede über das Eis im Glas und „Energiefeldern, die sich anziehen“: Das ist der Sextalk des Physikers. „Hier gibt es ja gar keine Küche!“, ruft Kitty dann erzürnt bei der Erstbegehung des gemeinsamen Hauses in Los Alamos. „Das kriegen wir hin“, versichert ihr J. Robert und hört kaum zu. Im Film verbleibt Blunt, wie auch Florence Pughs tragische Kommunistin Jean, als eine Art „Astronaut’s Wife“, also eine Frauenfigur, die vor allem als klagende und weinende bessere Hälfte am Geschehen nicht teilnehmen kann.
Das Casting wird zu einem zunehmenden Problem für Christopher Nolan, dem neben Steven Spielberg und Quentin Tarantino unter Schauspielern begehrtesten Filmemacher. Alle wollen mit ihm zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu Spielberg und Tarantino sagt Nolan aber wohl auch allen zu. Schon in „Interstellar“ wurden die kleinsten, fast eher als Cameos zu bezeichnenden Nebenrollen äußerst prominent besetzt – William Devane, David Oyelowo, Ellen Burstyn. Man erwartet, dass sie aufgrund ihrer Prominenz etwas Großes im Film tun werden – und dann tauchen sie schnell ab.
„Ritterschlag eines Kurzauftritts“
In „Oppenheimer“ sind es Rami Malek, Casey Affleck, Matthias Schweighöfer, Matthew Modine und sehr viele mehr, die größer als ihre Rolle bleiben, eben weil sie keinen Raum erhalten, ihre Figuren zu füllen. Bei keinem anderen Regisseur geben die Stars sich mit so wenig zufrieden, und doch bleibt keinem genug Zeit, um zu glänzen. Kenneth Branagh erhält nach seinen Hercule-Poirot-Übungen sowie derjenigen als Oligarch in „Tenet“ erneut die Gelegenheit, an seinen Akzenten aus den Königreichen der Fantasy zu arbeiten. Branagh ist netto für zwei Minuten zu sehen. Hat er sich jemals kleiner gemacht als hier? Was sagt das über ihn aus, was über die in Hollywood zelebrierte, uferlose Bewunderung für Nolan, das ersehnte Ehrgefühl, von diesem Regisseur mit dem „Ritterschlag eines Kurzauftritts“ ausgezeichnet zu werden?
Schnittstelle zwischen brillanten Wissenschaftlern und dem Militär
Da verwundert es geradezu, dass Nolan nicht seinen Lieblingsschauspieler Michael Caine engagierte. Caine hätte doch gut die Performance John Gowans‘ übernehmen können, der in der Rolle des Ward Evans als einer von drei Untersuchungsausschuss-Mitgliedern über Oppenheimers Zukunft im Wissenschaftsbetrieb entscheidet. Am ehesten überzeugt noch Tom Conti als resignierter, wie ein Muppet aussehender Albert Einstein. Einstein war jener Mann, der das Universum wie kein anderer vor ihm erklären konnte, aber auf Erden bei starkem Wind nicht den Hut aufbehalten kann, wie Nolan in einer gefühligen Aufnahme zeigt. Man wünscht sich fast, Einstein würde den „Oppenheimer“-Leuten öfter mal seine berühmte Zunge entgegenstrecken.
Ähnlich stark ist Matt Damon, der die undankbare Rolle des General Groves übernimmt, also die Schnittstelle zwischen brillanten Wissenschaftlern und dem Militär, dessen Soldaten das meiste nicht verstehen, aber solange Aufgaben erfüllen müssen, bis sie Oppy und sein Team endlich entmachten können – „no offence, aber ab hier übernehmen dann wir“. In Roland Joffes „Schattenmacher“ spielte Paul Newman den General als bellenden Haudrauf, Damon schenkt Groves einen Sarkasmus, den nur Menschen haben können, die mit Menschen zusammenarbeiten, deren geistige Höhen sie nicht erreichen.
Christopher Nolan und sein Kameramann Hoyte van Hoytema haben nicht nur auf IMAX 65mm gedreht, sondern auch in analogem IMAX-Schwarzweiß, was „Oppenheimer“ allerdings weniger wie einen Nolan-, sondern erstaunlicherweise wie einen David-Fincher-Film aussehen lässt (was natürlich auch daran liegen kann, dass Robert Downey, Jr. mitspielt, als auch Gary Oldman, der für die Darstellung historischer Figuren anscheinend nur noch mit schwerem Gesichts-Make-Up auftreten will). Viele entscheidende Ereignisse werden – es soll viel Stoff in diesen Dreistunden-Film hinein, es passt aber nicht viel hinein – nur angerissen.
Langzeitfolgen des Fallout
„Ich will mich nicht aus dem Projekt verabschieden, nur weil Plutonium radioaktiv ist“, sagt eine Trinity-Test-Forscherin und verweist dabei nebensächlich auf die Langzeitfolgen des Fallout. Immerhin wird die menschenverachtend anmutende Frage erörtert, ob die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki dazu geführt haben, dass die Zahl der Kriegsopfer im Pazifik nicht noch höher ausfiel – die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine Infanterie-Invasion Japans auf beiden Seiten nicht zu noch höheren Opferzahlen geführt hätte. Dabei traf es in Hiroshima und Nagasaki nicht Soldaten, sondern Zivilisten. „Oppenheimer“ scheut sich nicht, die „Falken“ und „Tauben“ im Militärstab miteinander ringen zu lassen.
Bau der Atombombe
J. Robert Oppenheimer sympathisierte mit dem Kommunismus, war aber kein Kommunist. Das reichte dem Untersuchungsausschuss – der über ihn in einem abgetakelten, ausgeräumten Büro verhandelt, eine ästhetisch klare, befriedigende Szenenanordnung Nolans – allerdings nicht. Das Versagen der „Sicherheitsgarantie“ ihm gegenüber, der Ausschluss aus Regierungsprojekten nagte schwer am damals 50-Jährigen. Dabei hat seine politische Haltung beim Bau der Atombombe vielleicht eine kleinere Rolle gespielt als gedacht. Oppenheimer wollte einfach für das richtige System die richtige Entscheidung treffen, den richtigen Leuten helfen, die ihm wiederum die richtigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit er jene Waffe baut, die das Deutsche Reich niemals haben dürfte.
Oppenheimer hat uns eine Welt hinterlassen, in der das Überleben der jeweils nachfolgenden Generation nicht mehr gesichert ist. Warum gibt es keine einzige Szene, in der er mit seinen zwei Kindern zu sehen ist? Wie er mit ihnen redet oder sie wenigstens ansieht? Das hätte Einblick gegeben in die Dinge, die ihm wichtig waren – oder eben nicht wichtig waren.
Was der ewig kleine Junge im erwachsen gewordenen Genie dazu gesagt hätte, ob seine Träume zumindest mit der Konstruktion einer Bombe in Erfüllung gingen, das hätte man gerne gesehen. Ob damit eher die Albträume des kleinen Jungen in Erfüllung gingen, auch. Die bewegendste Szene kommt gleich zu Beginn: Der junge Oppenheimer, der noch nicht weiß, was das Leben soll, liegt im Bett, zieht sich die Decke über den Kopf und weint ein Fenster an, auf das der Regen prasselt.
Mehr zu „Oppenheimer“:
Unabhängig vom dramatischen Potenzial der Geschichte rund um den Physiker beeindruckte Regisseur Nolan schon vor Abschluss der Dreharbeiten mit der öffentlich gemachten Behauptung, eine Atombombenexplosion nicht mit Computereffekten erzeugt zu haben. Seitdem denken viele Fans des Filmemachers, der in seinen Werken fast sklavisch versucht, mit handgemachten Actionsequenzen ein Höchstmaß an Naturalismus und Authentizität herzustellen, darüber nach, ob es sich sogar um eine echte Atombombenexplosion handeln könnte.
Wenige Stunden vor dem (deutschen) Kinostart am 20. Juli meldete sich der britische Exzentriker via „Hollywood Reporter“ zu diesem im Grunde verrückten Gerücht zu Wort. „Es ist einerseits schmeichelhaft, dass die Leute mir etwas so Extremes zutrauen“, sagte Nolan, „aber es ist auch ein bisschen beängstigend.“