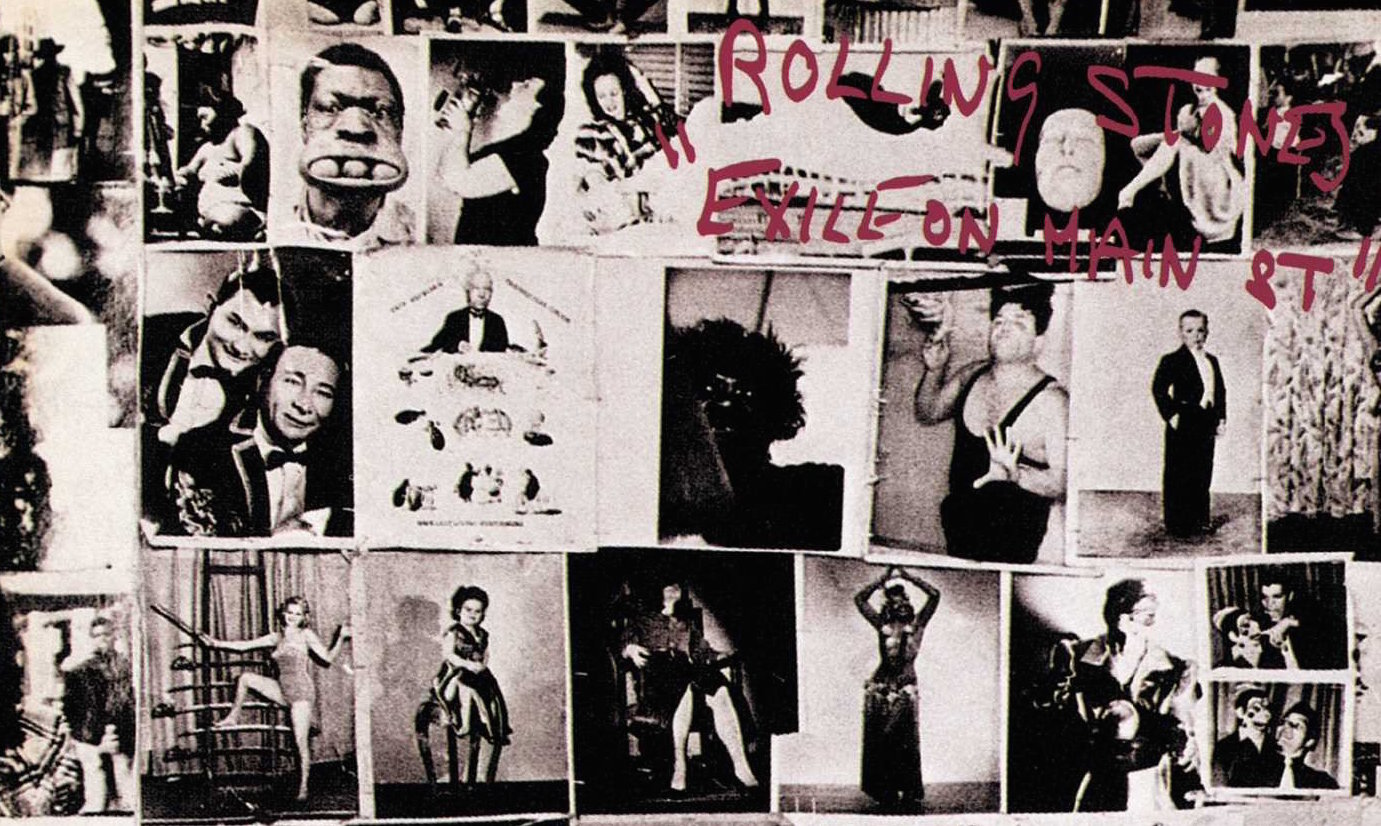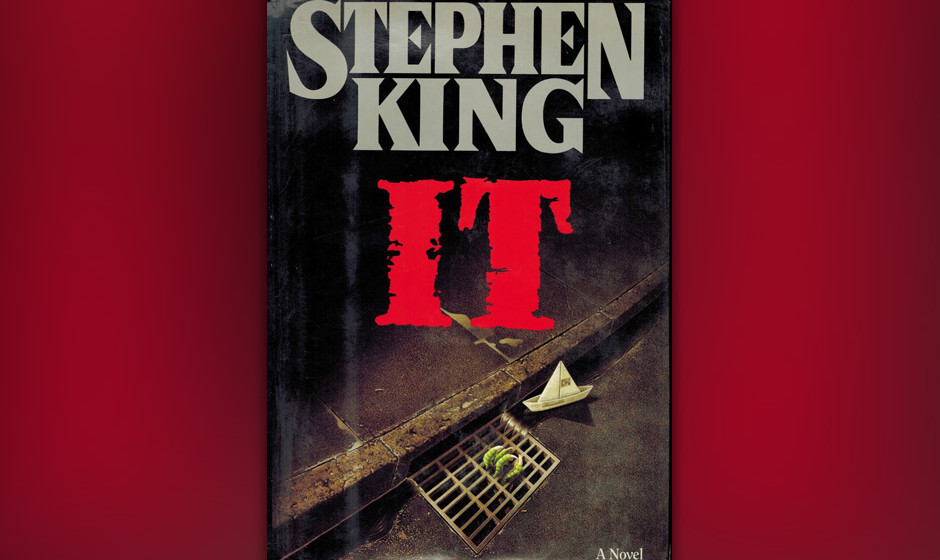Fenne Lily
„Big Picture“ – Trend: Tristesse
Dead Oceans/Cargo (VÖ: 14.4.)
Eine deprimierte junge Britin, like Phoebe Bridgers never happened

Das dominante Indie-Klischee der Gegenwart ist eine deprimierte Alltagslyrik, in der existenzielle Angst ausgedrückt wird, von einer jungen Frau mit viel Luft in der Stimme und einer Monotonie in der Melodie, die das Chronische ihres Zustands ausdrückt. Als Phoebe Bridgers das vor fünf Jahren gemacht hat, war es berührend, und als Phoebe Bridgers das vor drei Jahren gemacht hat, war es berührend, und auch als einige ihrer Weggefährtinnen und Epigoninnen es in den vergangenen Jahren gemacht haben, war es berührend. Aber mittlerweile ist dieser Emo- und Pop-Rock-inspirierte Folk eben zum hegemonialen Indie-Sound geworden, zur Konvention, zum Klischee, und weil die Form so vertraut ist, nimmt man sie nicht mehr als originellen Ausdruck, als künstlerische Notwendigkeit wahr, sondern eben als generisch, als die sichere Wahl – als das, was man eben macht.
Die emotionale Kraft liegt in Lilys zaghaften Melodien, die schön sind, wenn ihre Persönlichkeit auch kaum erkennbar wird
In diesem zeitgeistigen Kontext begegnet man Fenne Lilys drittem Album, das bestens in den Trend der Tristesse passt, aber wohl auch andeutet, dass es mit ihm bald vorbei sein könnte. „Map Of Japan“, der erste Song, ist der beste, mit einer einfachen Akkordfolge und einem schönen Arrangement, zaghaften Doo-Wop-Backings, einer wunderbaren, mächtig verhallten E-Gitarre und Fenne Lilys zittriger Stimme. Auch „In My Own Time“, ein wehmütiger Walzer, ist schön. Von den übrigen Liedern bleiben vorallem die Eigenheiten der Backing-Band hängen, die hell verhallte Gitarrenfigur nach dem Refrain von „Lights Light Up“ zum Beispiel oder überhaupt die warme Dichte der Arrangements.
Fenne Lily erzählt emotionale Gespräche nach, richtet sich an ein romantisches Gegenüber, schreibt in Dialogen und dramatischen Szenen, die dann doch sehr einfach sind: Ein Flyer, auf dem etwas über „some guy called Jesus“ steht, wird unter ihrer Tür durchgeschoben, sie klebt ihn an den Kühlschrank – „who knows, someday I might need it“. Ihr Songwriting müht sich, das Universelle im Spezifischen zu finden. Aber die emotionale Kraft liegt eher in Lilys zaghaften Melodien, die schön sind, wenn ihre Persönlichkeit auch kaum erkennbar wird.