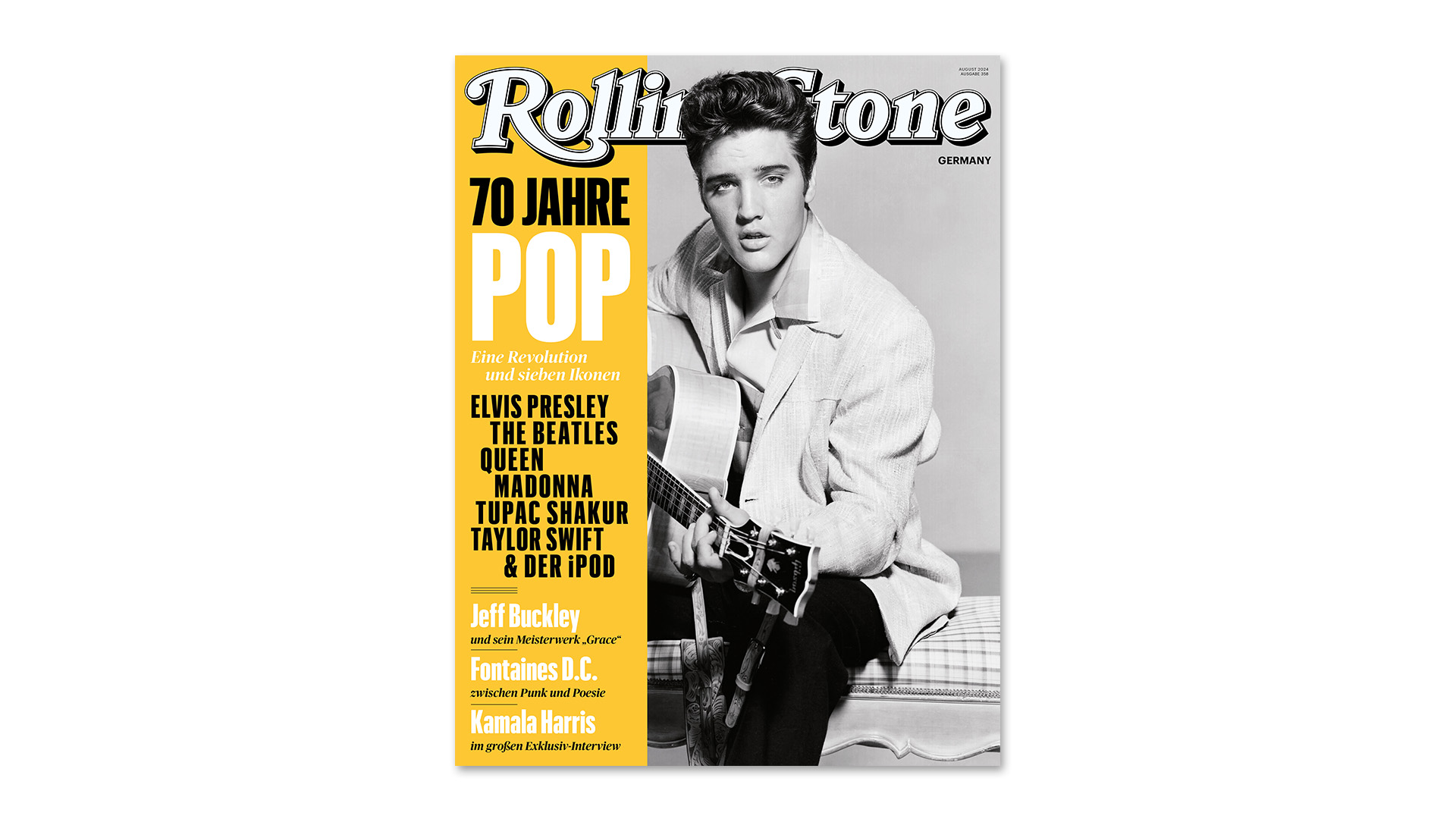Florence + The Machine
„Dance Fever“ – King Florence
Universal (VÖ: 13.5.)
Betörendes zwischen Tanzfläche, Wankelmut und Zerealien
Es geht stark los. In den ersten Zeilen des ersten Songs, „King“, legt Florence Welch gleich ihre größten Probleme auf den Tisch: „We argue in the kitchen about whether to have children/ About the world ending and the scale of my ambition/ And how much is art really worth.“ Wie kann eine Frau zurechtkommen, die vieles auf einmal will – und nicht mal weiß, ob ihre Musik angesichts der Weltlage noch etwas bedeutet? Eine Frau sei eine wankelmütige Gestaltwandlerin, erklärt die Sängerin später, und dann entscheidet sie sich doch: „I am no mother, I am no bride, I am King.“ Rückt zur Seite, Könige, hier komme ich! Mit allen Selbstzweifeln, mit aller Unsicherheit, und trotzdem: wild entschlossen.
Florence lädt zum Tänzeln ein, bei dem gleichzeitig Nachdenken möglich ist
Leider hält der Rest ihres fünften Albums nicht ganz mit diesem Statement mit. Mit den Aufnahmen begonnen hat Florence vor zwei Jahren in New York mit Stammproduzent Jack Antonoff, dann warf die Pandemie sie nach London zurück. Sie wandte sich an Dave Bayley (Glass Animals), der ihr etwas mehr Club-Sounds verpasste. Aber so richtiges „Dance Fever“ kommt nicht auf, und das ist ja auch nicht nötig. Zum Tanzen animieren können andere besser, Florence lädt zum Tänzeln ein, bei dem gleichzeitig Nachdenken möglich ist.
Der Beat ist selbst bei „Choreomania“, einem Lied über ein tödliches Tanzritual, nicht allzu aufdringlich, selbst wenn hier alles auf Euphorie und Mitschwelgen ausgelegt ist. Die Betörung findet anderswo statt – wenn sich Florence als Songschreiberin an den klassischen Kolleginnen orientiert (Emmylou Harris, Lucinda Williams et al.) –, und wie in „Girls Against God“ das Leben lakonisch beschreibt: „It’s good to be alive/ Crying into cereal at midnight.“
Ob sie sich als „Dream Girl Evil“ inszeniert, das keine Lust mehr hat, den Vorstellungen des Geliebten zu entsprechen, oder in „Morning Elvis“ zugibt, sich oft doch gar nicht königlich zu fühlen: Lyrik und Stimme treffen zielsicher verschiedene Nerven, nur den Melodien fehlt manchmal dieser Zunder. „Sometimes you get the girl/ Sometimes you get the song“, singt sie in „The Bomb“. Die Frau ist momentan noch stärker als der Song.