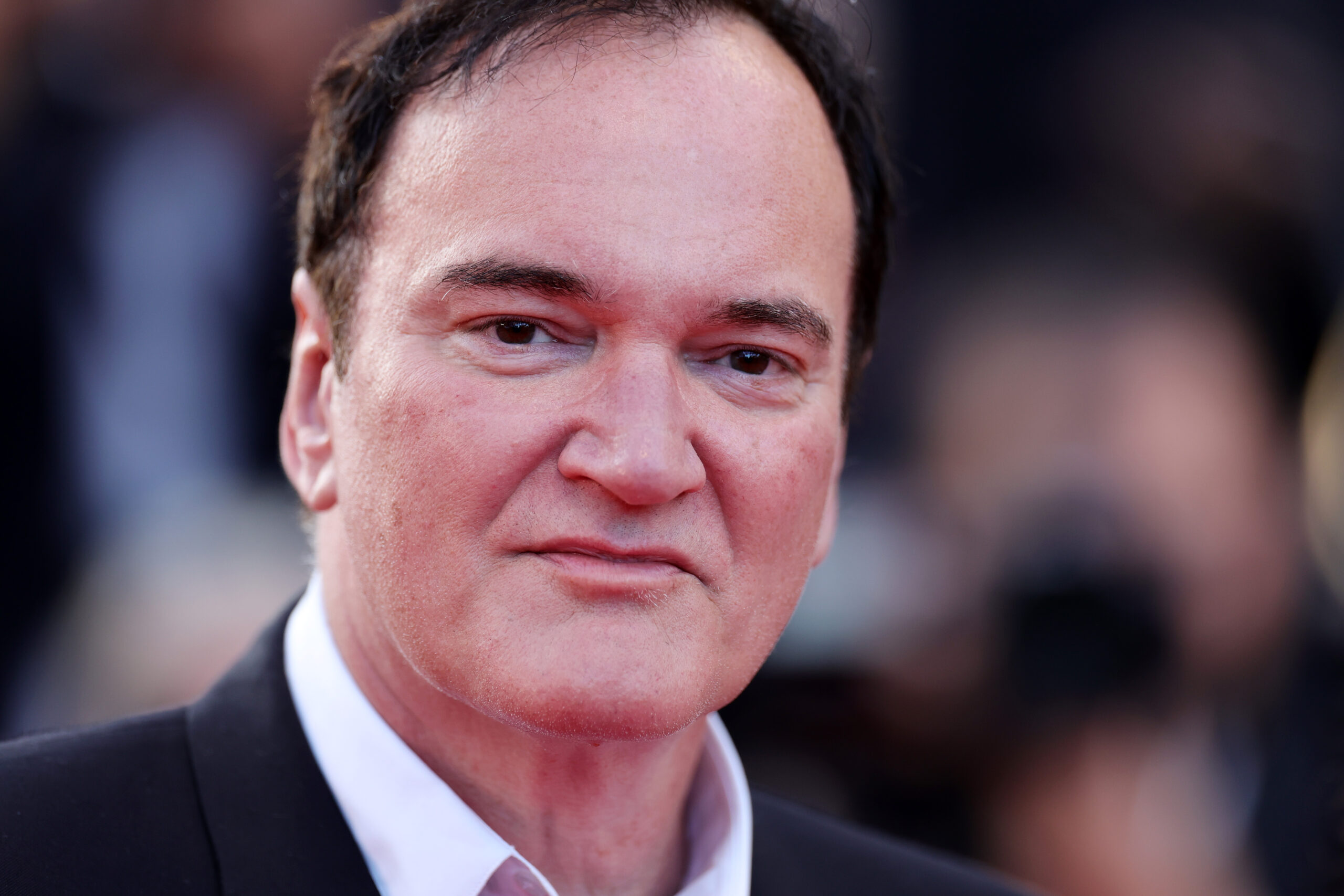Buch-Kritik: „Es war einmal in Hollywood“ – Quo Vadis, Quentin?
In der Novelization seines Films „Once Upon A Time … In Hollywood“ vertieft Quentin Tarantino das Leben seiner Kino-Protagonisten: ein abgehalfterter Schauspieler und sein Stuntman-Freund, die unterschiedlich mit dem Ende der „Goldenen Hollywood“-Ära umgehen. Für einen Roman taugt das leider nicht.
„Once Upon A Time … In Hollywood“ sei so nah an „Pulp Fiction“ dran wie kein anderer Film, sagte Quentin Tarantino 2019, und es klang so, hätte er uns das versprechen müssen. Einlösen konnte er das Versprechen nicht. Er zeigte langweilige Autofahrten, langweilige Aufbereitung von Hundefutter und langweilige Reparaturarbeiten auf einem Dach. Sogar der Roman-Polanski-Darsteller wird meist beim Autofahren gezeigt, und die Sharon-Tate-Darstellerin dabei, wie sie einen Film über sich selbst im Kino ansieht. Dass Tarantino nun eine Novelization nachlegt, ist die Pointe. Novelizations sind die Pulp Fiction der Taschenbuch-Literatur, von Autoren, die nicht so bekannt sind wie der Film, die dafür aber die Story um jene Elemente weiterspinnen, die es höchstens in einen Director’s Cut schaffen würden.
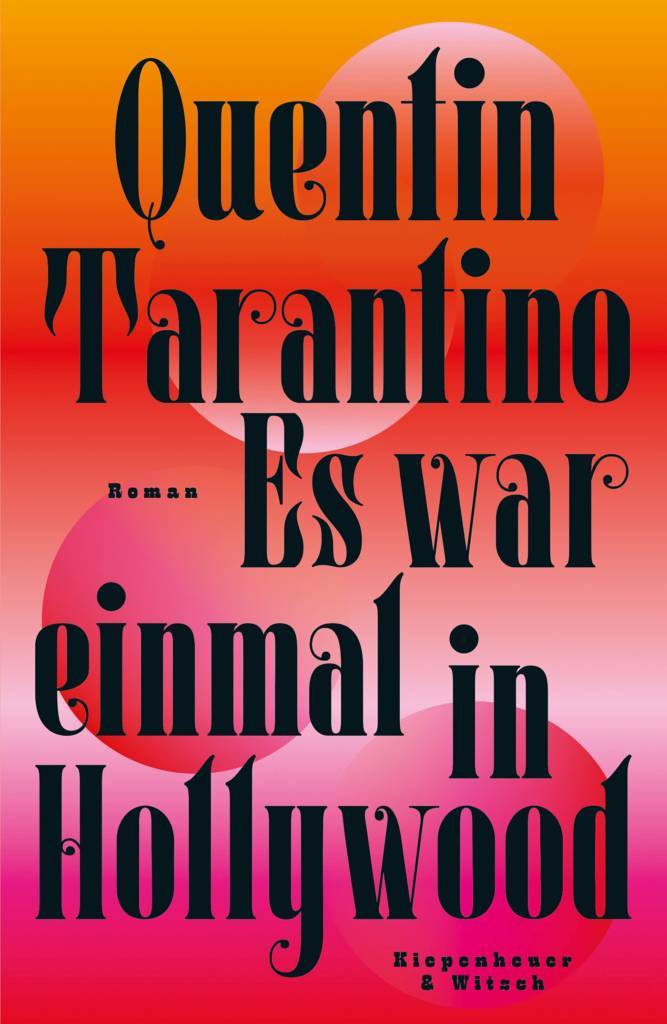
Tarantinos Deutungen der Kinogeschichte finden sich überall im Netz, sie sind gerappte Filmtheorie. Martin Scorsese weiß vielleicht mehr als er, aber er ist kein so guter Erzähler. Im Roman bezeichnet Tarantino sein Vorbild Kurosawa als Pulp-Regisseur, und er kann es begründen, er bezeichnet Antonioni als Blender, und er kann es begründen, und er bezeichnet Otto Preminger als „Nazi-Drecksack“ und kann es nicht begründen. Das heißt, es ist nicht Tarantino, der Sachen begründet oder nicht begründet. Es sind seine Figuren, wie die des Cliff Booth, ein Stuntman. Und das ist das Problem dieses Buchs. Manchmal klinkt sich Tarantino unschön selbst als erzählender Professor ein, aber meistens lässt er Booth philosophieren. Im Film ein schweigsamer Draufgänger, erklärt uns Booth hier das Kino des 20. Jahrhunderts, das er doch, anders als Jahrzehnte später der ehemalige Videothekar Tarantino, unmöglich komplett aufgesaugt haben kann.
Warum kein Nachschlagewerk: „Verkannte Meisterwerke vor 1969“?
Der Film handelt vom Abstieg des mitteltalentierten Schauspielers Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), und seines unbekümmerten Doubles (Brad Pitt), die die Geschichte Amerikas derart verändern, dass daraus ein Märchen wird. Sie retten, ohne es zu wissen, in Notwehr das Leben Sharon Tates und sechs anderer Menschen, indem sie Anhänger der „Family“ Charles Mansons töten, die in ihr Haus eingedrungen sind. Den Roman aber nutzt Tarantino vor allem für Kultur-Aufsätze. Die Monologe seiner Figuren über europäisches Arthouse-Kino und das Ende der „Goldenen Ära“ Hollywoods hätte er besser als Nachschlagewerk mit dem Titel „Verkannte Meisterwerke vor 1969“ veröffentlicht. Für einen Roman ist das nichts.
Denn allein schon Tarantinos Abhandlung über Winnetou wäre eher ein Western-Lexikon wert. Sie enthält seinen Witz, das plain talking eines Auskenners, der von oben auf die Dinge schauen kann: „Ein deutscher Western? Was zur Hölle soll das sein? Ein deutscher Western mit einem verdammten französischen Indianer?“ Leider zeigt sich sein Sprachgenie selten. Sätze wie „Vilgot Sjömans Film ‚Ich bin neugierig (gelb)‘ ebnete den Weg für eine neue Sexualitätswelle im modernen Mainstream-Kino“ könnte in „Cahiers du Cinema“ stehen, aber nicht von Cliff Booth gedacht werden.
Trutschige Übersetzung: „Da sieht’s aus wie bei Hempels unterm Sofa“
Noch abstruser ist der Einfall, Charles Manson über das Filmbusiness sinnieren zu lassen: „Wie Pauline Kael einmal schrieb: ‘In Hollywood konnte man an Zuspruch zugrunde gehen.‘“ Warum sollte Manson die New Yorker Filmkritikerin zitieren? Warum schiebt Tarantino ihn als sein Sprachrohr vor? Zum Glück hat er in seinen Filmen selten Voice-Over verwendet, also verlautbarte Gedanken, sonst gebe es wohl nur noch Stimmen bei ihm und keine Stille mehr. Dazu kommt eine trutschige Übersetzung, die, ein No-Go, auch in Redewendungen endet, wie es sie in den Drehbuch-Übersetzungen nie gab: „Da sieht’s aus wie bei Hempels unterm Sofa.“
Booth ist einer der reizvollsten Charaktere aus dem Tarantino-Kosmos, weil sein Hintergrund im Film ein Geheimnis bleibt. Seine erste Figur, die interessant ist, gerade weil sie kaum redet. Im Roman wird Booth leider voll ausgestattet, mit einer Biografie als Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg, und auch der viel diskutierte Moment mit der Harpune auf dem Boot – hat er seine Frau ermordet oder nicht? – wird leider aufgeklärt. Rick Daltons Entwicklung ist klarer und zumindest im Roman vollendet. Den Aufstieg schafft er nicht mehr, aber er wird zur Kurzzeit-Celebrity, weil er per Flammenwerfer die verhassten Hippies erledigt. Er erkennt die Ironie darin, dass er Hippies seinen neuen Ruhm zu verdanken hat.