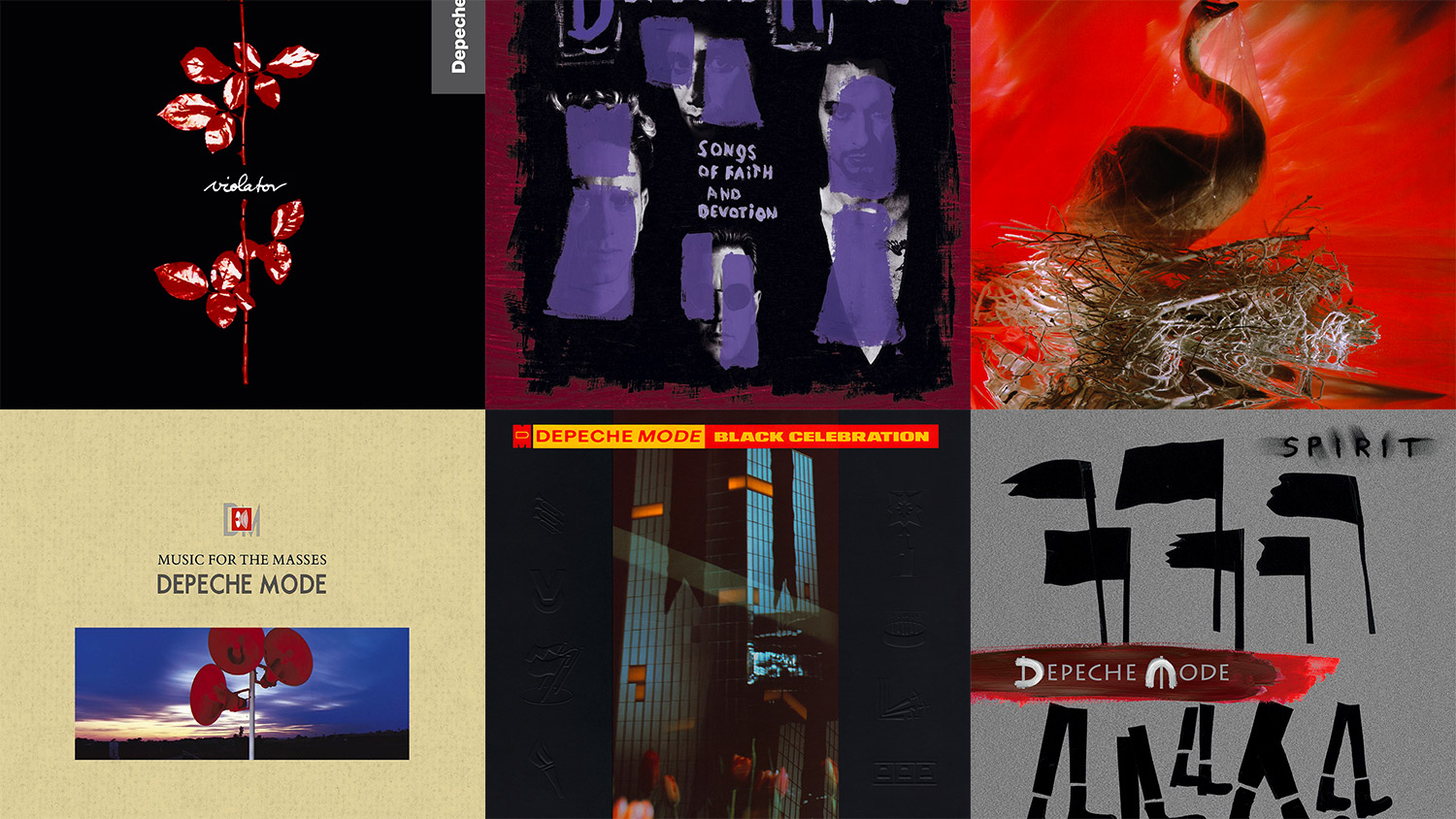Klassiker einer Ära: Die 10 besten Alben des Britpop
Britpop bestimmte in den 90ern die musikalische Landschaft in England. ROLLING STONE listet die 10 besten Alben jener Zeit.

Die Grundlage des Britpop: The Stone Roses – „The Stone Roses“ (1989)
Bis dahin waren es unstete, unbefriedigende Jahre in der englischen Popkultur, ohne Richtung und Reibung. Maggie Thatcher, lange sinn- und solidaritätsstiftendes Feindbild, war im Begriff, sich selbst vollends zu demontieren, als sich Factory-Eigner und Hacienda-Betreiber Tony Wilson in einem Akt waghalsiger Geschäftstüchtigkeit weit aus dem Fenster lehnte und „Madchester“ zum Mittelpunkt der Welt erklärte. Die Zukunft des Pop sei seine Tanzbarkeit, so der smarte Tony, in der Eroberung des Dancefloor mit Gitarren. Und genau dies ereignete sich in Manchester.
In der Retrospektive erwies sich der Marketing-Schachzug sicherlich als eine sich selbsterfüllende Prophezeihung und als ein Lehrstück in Sachen Medienmanipulation. Die Stone Roses profitierten davon erheblich. Nicht nur, weil sie in den folgenden Monaten mit „Elephant Stone“, „Made Of Stone“ und „One Love“ respektable Hits landeten. Nicht nur, weil ihr Album so doch noch zum Bestseller wurde, sondern vor allem, weil sie zur wichtigsten Inspirationsquelle einer ganzen Generation von Musikern wurden. Die Generation des Britpop. Fast drei Jahre lang galten sie als coolste Band auf dem Planeten. Alles wurde nachgeahmt, von John Squires Art, die Gitarre zu halten über Ian Browns Watschelgang bis hin zu Manis Kopfbedeckungen und Renis Hosen. „Ihr Stil war so perfekt wie ihr Timing“, erinnert sich Noel Gallagner, „sie waren im richtigen Moment am richtigen Ort.“
Von New Wave zum „Father of Britpop“: Paul Weller – „Stanley Road“ (1995)
Gemeinsam mit den Stone Roses trägt Paul Weller den Titel als „Father of Britpop“. Nach den Erfolgen mit The Jam und The Style Council arbeitete er ab 1991 an seiner Solo-Karriere, die 1995 mit „Stanley Road“ ihren Höhepunkt erreichte. Wellers dritte Solo-Platte erhielt in Großbritannien vierfach Platin und ist bis heute seine erfolgreichste Veröffentlichung.
Es sind aber weniger die Verkaufszahlen, die „Stanley Road“ zu einem großartigen Album machen. Vielmehr ist es die vermittelte Positivität und die Freude am Musikmachen, derer man sich beim Hören nicht entziehen kann. Das Album ist nach der Straße benannt, in der Weller im englischen Woking aufwuchs, und dient als deutliche Referenz an seine britische Herkunft. Mitunter erinnert der Titeltrack an Fleetwood Macs „Don’t Stop“ vom Album „Rumours“, das Fleetwood Macs Äquivalent zu Paul Wellers „Stanley Road“ ist: ihr Opus magnum.
Außerdem war der Zeitpunkt Gold wert, zu dem das Album veröffentlicht wurde. Britpop stand auf der Schwelle des absoluten Mainstreams im vereinigten Königreich. Weller verknüpfte auf „Stanley Road“ einerseits durch seine eigene Person sowie andererseits mit Gastmusikern wie Steve Winwood und Noel Gallagher unterschiedliche Epochen britischer Pop-Geschichte. Abgerundet wurde die Veröffentlichung durch das Artwork von Peter Blake, also von niemand Geringerem als dem Designer des „Sgt.Pepper’s“-Cover. Weller selbst blickt nach wie vor zufrieden auf das Highlight seiner Karriere:
„Von „Stanley Road“ spielen wir live immer noch viele Songs, das sagt ja schon einiges über die Langlebigkeit des Albums. Vielleicht sind die ersten beiden Solo-Alben so was wie der Auftakt für dieses dritte. Da kam alles zusammen, alles passte. Durch die vielen Konzerte hatte ich ein enormes Selbstbewusstsein, was das Spielen betrifft, und die Lieder kamen wie von selbst. Einmal kam auch Noel Gallagher vorbei, trank ein paar Gläser und musste dann ein bisschen mitspielen.“
Morbider Britpop: Suede – „Dog Man Star“ (1994)
Suede haben Britpop gehasst. Ihr Sänger Brett Anderson bezeichnete diejenigen, die dem sogenannten Laddism nacheiferten und dabei die Haltung der britischen Popkultur Mitte der 90er Jahre personifizierten, als „Sozialtouristen“. Leute aus der Mittelschicht gaben sich als Zugehörige der Unterschicht aus, indem sie bei der Fußball-EM 1996 nach Bier brüllten („Lager! Lager!“, wie im Underworld-Hit „Born Slippy“) oder dem Heroin-Schick von „Trainspotting“ huldigten.
Anderson, der aus ärmsten Verhältnissen stammt, stellte sich mit rigoroser Abneigung gegen das unliebsame B-Wort: „Musiker, die in den Neunzigern die britische Nationalflagge schwenkten: Das war keine Mode, sondern ekelhafter Nationalismus! Ein paar Idioten, die auf der Bühne den Union Jack hochhielten. Britpop war leider nicht mehr als das.“
Dass sie neben Oasis, Blur und Pulp trotzdem in den Stand der „Big Four“ des Britpop erhoben wurden, konnten Suede nicht vermeiden. 1991 adelte sie der damals auf der Insel einflussreiche „Melody Maker“ als die größten Gitarrenpop-Musiker seit den Smiths – und das, ohne dass sie einen einzigen Song veröffentlicht hatten. Ihrem selbstbetitelten Debüt folgte 1994 schließlich „Dog Man Star“, kurz nach den ersten Lebenszeichen diverser Künstler, die man bald in der Britpop-Ecke verortete. Dabei hatten Suede ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: Eine Mischung aus Glam-Rock, Clownstränen, Arbeiterklasse und drogeninduzierten „Dungeons & Dragons“-Fantasien.
Wie unpeinlich Pop und Klassik miteinander harmonieren können, bewiesen Suede mit dem viel geliebten, orchestral begleiteten Song „Still Life“, der „Dog Man Star“ als wuchtiges Finale beschließt. Der einzige Song, der es ihnen in einer ähnlichen Weise gleichtun konnte, ist Elbows „Mirrorball“ vom herausragenden Album „The Seldom Seen Kid“ (2008).
Britpop im neuen Gewand: Blur –„Blur“ (1997)
Einer der Gründe, weshalb Suede das Etikett des Britpop verabscheuten, waren Blur. Genauer gesagt: Damon Albarn. Justine Frischmann, Gründungsmitglied von Suede und spätere Sängerin von Elastica, verließ Brett Anderson für Albarn. Mehr muss nicht gesagt werden. Millionen Blur-Fans waren allerdings weniger voreingenommen.
Blur gehörten 1997 längst zu den größten Bands Englands. Der Britpop-Hype war ihre Plattform und sie manifestierten ihr Standing über vier Alben zu Beginn und Mitte der 1990er, nicht zuletzt durch die Rivalität und das öffentlich zur Schau gestellte Wetteifern um die höheren Verkaufszahlen mit Oasis. Anders aber als ihre größten Konkurrenten aus Manchester waren Blur auf ihrem selbstbetitelten Album zur Wagnissen bereit. Sie wendeten sich von ihrem bisherigen Sound ab, der zu ihrem eigenen Markenzeichen und dem der gesamten Britpop-Ära geworden war. „Blur“ orientiert sich am amerikanischen Indie mit Lo-Fi-Einflüssen. Albarn und seine Mitmusiker schielten auf Dub („Essex Dogs“) und nahmen den Grunge mit „Song 2“ auf die Schippe. Ihr Mut zahlte sich aus und „Blur“ avancierte zum erfolgreichsten Album der Band. Der Schritt, sich aus der Wohlfühl-Zone zu verabschieden, verdient Respekt.
Sogar in den USA schafften Blur dank „Song 2“ den Durchbruch. Viele ihrer britischen Kollegen haben sich daran die Zähne ausgebissen – Blur schafften es durch einen missverstandenen Joke. Ebenso wie der Erfolg in Amerika war die Entstehungsgeschichte des Songs mehr oder weniger Zufall. Das Album war bereits fertig und die Band feierte im Studio eine Party. Im Zuge der Feierlichkeiten spielten sie spontan das Lied ein, das sie auch über die Grenzen Großbritanniens berühmt machte.
Aus Trümmern: The Verve – „Urban Hymns“ (1997)
„Urban Hymns“ von The Verve erschien so wie „Blur“ nach dem eigentlichen Zenit des Britpop. Schlechter macht es das Album keineswegs. Mit ihrem dritten Album verabschiedete sich die Band aus Wigan vom Shoegaze und machte sich auf, zu einer der prägendsten englischen Bands der späten 90er zu werden. Bevor das größte Album ihrer Geschichte entstand, durchliefen The Verve jedoch eine kurze Krise. Frontmann Richard Ashcroft und Gitarrist Nick McCabe konnten ihre Differenzen nicht überbrücken, sodass The Verve zwischenzeitlich nicht mehr existierte. Nur wenige Wochen nach der Trennung fand sich die Gruppe wieder zusammen – allerdings ohne McCabe. Ashcroft besann sich auf die Stärken der Band und sprang über seinen Schatten. Er rief McCabe an und bat ihn, wieder bei The Verve einzusteigen, nachdem die übrigen Mitglieder realisierten, dass ohne den ehemaligen Gitarristen ein wichtiges Puzzle-Stück fehlte.
Das abgedroschene Klischee des Phönix aus der Asche wurde bei The Verve und ihrem bahnbrechenden Album „Urban Hymns“ zur Wirklichkeit. Der Song „Neon Wilderness“ verweist noch auf die Vorgänger-Alben mit ihren flächigen, verträumten Gitarren-Arrangements und dem psychedelischen Einschlag. „The Rolling People“ und „Come On“ sind dagegen deutlich gradliniger und verhelfen „Urban Hymns“ zu einer gelungenen Dynamik. Das Album ist weit, ohne sich zu verlieren. Es ist strukturiert, ohne steif zu wirken.
Der einzige Nummer-Eins-Hit von The Verve ist „The Drugs Don’t Work“, doch der unbestritten bekannteste Song ist und bleibt der Album-Opener „Bittersweet Symphony“. Als Vorlage für das weltberühmte Orchester-Sample diente die Orchester-Version des Rolling-Stones-Songs „The Last Time“ – Rechtsstreitigkeiten inklusive. Spätestens durch die Verwendung des Liedes im Film „Eiskalte Engel“ wurde „Bittersweet Symphony“ legendär.
Wahn und Getöse: Manic Street Preachers – „The Holy Bible“ (1994)
Es war das Album von Richey Edwards und sein letzter Schrei: ein Bündel aus vollmundigen Zitaten, nicht ganz verstandener Philosophie, Sozialromantik, Wortspielen, spätpubertärer Poesie und Abneigung gegen die Welt. Live hampelte Edwards neben den drei Musikern herum, selten im Bild; Poster-Boy, Ketzer und Märtyrer zugleich. Fünf Bücher las Edwards in einer Woche, so Nicky Wire im Rückblick – da konnte der Bassist nicht mithalten, der 1994 geheiratet hatte und gern daheim staubsaugte. Von Richey Edwards stammten die meisten Texte, der dann die Brocken James Bradfield hinwarf, der zu „Yes“, „Archives Of Pain“ und „Revol“ die Musik schreiben musste. Der Sänger erinnert sich an seine erste Irritation.
„The Holy Bible“ war das Drittwerk der Manic Street Preachers, ein Ruf zu den Waffen nach dem aufgeblasenen „Gold Against The Soul“. Sie hatten realisiert, dass die Provokation von „Generation Terrorists“ schnell verflogen war. Jetzt hüllten sie sich in wüste und mit Orden behangene Militär-Lumpen, Bradfield zog sich eine Pudelmütze auf – und so rockten sie durch das englische Fernsehen: „Faster“, „P.C.P.“, „She Is Suffering“. Glastonbury. Reading. Gitarren zerschmettern. Die Revolution startet hier.
Aber es war nicht nur Getöse. James Bradfield gelangen einige seiner schönsten Songs zu den schwierigen Textmassen, „She Is Suffering“, „Die In The Summertime“, der unvergessliche Riff von „Faster“: „I am stronger than Mensa, Miller and Mailer.“ Damals wollte kaum jemand „The Holy Bible“ verstehen. Heute feiert die britische Musikpresse die unhandliche Kampfschrift gegen Konsumismus, die USA und Geistesträgheit als Triumph der Waliser – dabei war es eigentlich erst „Everything Must Go“, das die Manic Street Preachers allgemein beliebt machte. Da war Richey Edwards bereits verschwunden, galt über Jahre als verschollen, und mittlerweile als totgemeldet.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte: Pulp – „Different Class“ (1995)
Schenkt man dem Meister selbst Glauben, so entstand der Großteil der Texte dieser Platte innerhalb einer Nacht am Küchentisch. Flankiert von einer billigen Flasche Brandy und emotionalem Ungleichgewicht. Dass diese Arbeitsweise oft genug sehr ertragreich ist, dürfte Journalisten wie auch Studierenden bekannt sein.
Im Falle von „Different Class“ führte sie vor allem zu einer immensen Geschlossenheit des Inhalts: Jarvis Cocker zeichnete im Prinzip das Milieu, aber auch seinen eigenen Bewusstseinszustand, der sich wie schon beim stark unterschätzten Vorgänger „His’n’Hers“ aus allerhand latent sexuellen Rückblenden gespeist hatte. Dabei war aber auch die Ambivalenz des beginnenden Erfolges erkennbar: So ist neben den altbekannten Indiedisko-Hits „Common People“ und „Disco 2000“ vor allem „Sorted For E’s & Wizz“ zu erwähnen: „Oh is this the way the future’s meant to feel / Or just 20.000 people standing in a field“, heißt es hier. Was ursprünglich Milieustudie der Raver sein sollte, lässt sich in der Rückschau durchaus auch als Zustandsbeschreibung der erfolgreichen Live-Band Pulp lesen, der mit dieser Platte vor allem eines gelang: Den 1995 medial inszenierten Zweikampf zwischen Blur und Oasis souverän für sich zu entscheiden.
Jedermanns Liebling: Supergrass – „In It For The Money“ (1997)
Pulp gewannen die Auseinandersetzung zwischen Blur und Oasis also für sich. Inmitten des fraktionellen Streits Mitte der 90er-Jahre gab es jedoch einen verbindender Faktor in der Hitze der Britpop-Ära: Jeder liebte Supergrass, unabhängig von den verschiedenen kulturellen, geografischen oder sonst welcher Unterschiede. Ihr Humor spielte dabei eine entscheidende Rolle. Später in ihrer Karriere verkauften sie offizielle Ansteck-Buttons mit der Aufschrift „everyone’s second favourite band“. Jedermanns Zweit-Lieblingsband. Eher hätten Oasis ein Album mit Blur gemacht, bevor man sie diesen Satz über sich selbst hätte sagen hören.
Supergrass konnten über sich selbst lachen. Andere Bands machten große Ansagen, entweder verbal, in der Presse oder musikalisch, doch das Trio (später Quartett) aus Oxford erkannten das Absurde daran an, in einer erfolgreichen Popband zu spielen. Ihr zweites Album „In It For The Money“ trug diesen Wahnsinn bereits im Titel. Trotz des Namens war der Nachfolger ihres Debüts „I Should Coco“ vergleichsweise ernst. Die Unbeschwertheit wich zunehmend einer Nachdenklichkeit und sanften Melancholie, etwa in „It’s Not Me“. Tatsächlich ist das vielleicht schönste Merkmal des Albums die Bescheidenheit von Supergrass: Songs wie „Cheapskate“, „Sun Hits The Sky“ und das eher raue „Richard III“ sind deutliche Fortschritte in ihrem Songwriting. Die Harmonien, Arrangements und Rythmen sind ausgetüftelter als auf „I Should Coco“. Als die vieler ihrer Zeitgenossen im Britpop sowieso, aber es wird nie triumphierend präsentiert. Alles bleibt Song- und damit albumdienlich, was „In It For The Money“ zu einer der zehn besten Britpop-Platten macht.
Exkurs in den Britpop: Radiohead – „The Bends“ (1995)
Auf „The Bends“ deuteten Radiohead ihren Hang zum Artifiziellen bereits an. Die Britpop-Momente im Schaffen der Band finden sich auf diesem Album, auch wenn entrüstete Gegner dieser Meinung schnell den Finger heben mögen. Um „The Bends“ richtig einordnen zu können, muss man sich die Entstehungsgeschichte vergegenwärtigen. Tatsächlich befanden sich Radiohead am Scheideweg ihrer noch jungen Laufbahn. Nachdem sie es mit ihrem Debüt „Pablo Honey“ (1993) nicht geschafft hatten, sich ein originäres Profil zuzulegen und stattdessen auf postpubertäre College-Hymnen wie „Anyone Can Play Guitar“ setzten, drohten die internen Spannungen die Band auseinander zu dividieren.
Vor allem Thom Yorke setzte sich mit depressiven Schüben auseinander. In der Rückblende vermutlich der Nährboden für todtraurige und unglaublich schöne Songs wie „Fake Plastic Trees“. Er zweifelte zunehmend an der Zukunft der Band und sinnierte über Sinn und Unsinn des Weitermachens. Das ursprüngliche Release-Datum wurde von der Plattenfirma auf Ende 1994 angesetzt. Letztlich ein unfreiwilliges Druckmittel. Als klar wurde, dass die Band nicht ansatzweise fertig werden würde, drängte die Plattenfirma auf eine schnelle Single, die weit vor Albumveröffentlichung erscheinen sollte. Doch auch daraus wurde nichts.
Bis November 1994 tüftelten Radiohead, die ihren Standort für das letzte Drittel der Sessions in die legendären Abbey-Road-Studios verlagerten, an den Liedern. Johnny Greenwood avancierte zum Handwerker des Sounds. Er wechselte wahllos Gitarren, experimentierte mit Amplituden und entwickelte sich zunehmend zum kreativen Sparringspartner neben Yorke. Vielleicht ist es genau die Reizkulisse aus Erfolgsdruck und Zermürbung, die die Band schließlich rettete. Der Ruf von Radiohead im popkulturellen Kanon war nach diesem Album nicht mehr derselbe. Auch wenn die kommerziellen Höhepunkte noch bevor standen: Sie hatten sich Rückrat erkämpft und der Genius im Zusammenspiel wurde anders als auf „Pablo Honey“ nicht nur angedeutet.
Die Definition von Britpop: Oasis – „(What’s The Story) Morning Glory?“ (1995)
Das zweite Album von Oasis gehört zu den Meisterwerken der britischen Popgeschichte. Es ist nach „St. Pepper’s“ und Queens „Greatest Hits“ das dritt-meisterverkaufte Album in England und beinhaltet mit „Wonderwall“, „Champagne Supernova“ und „Don’t Look Back In Anger“ Klassiker von weltweiter Bedeutung. Die Songs auf „(What’s the Story)“ sind ein direkter Kontrapunkt zu denen auf dem Debütalbum „Definitely Maybe“ von 1994. „Das ganze erste Album dreht sich um Flucht“, sagte Noel Gallagher ROLLING STONE im Mai 1996. „Es geht darum, dem beschissenen, langweiligen Leben in Manchester zu entkommen. Das erste Album handelt vom Traum, ein Popstar in einer Band zu sein. Auf dem zweiten Album geht es darum, tatsächlich ein Popstar in einer Band zu sein.“
Gewohnt großkotzig sagte Noel in einem seiner ersten Interviews: „Wenn du als Band nicht größer als die Beatles werden willst, dann ist deine Band nur ein Hobby.“ Größer als die Beatles, das haben Oasis sicher nicht geschafft. Ihren Platz in der obersten Loge des Popadels haben sie sich dennoch erspielt, und das zu einem Großteil durch „(What’s the Story) Morning Glory“. Die Rolle des Albums im Kontext des Britpop wird dabei beinahe zur Nebensache. Klar, die ganze Sache mit Blur war 1995 ein riesen Ding, doch wen juckt das heute noch? Die Musik – der eigentliche Kern – ist davon übrig geblieben, und das ist auch gut so.