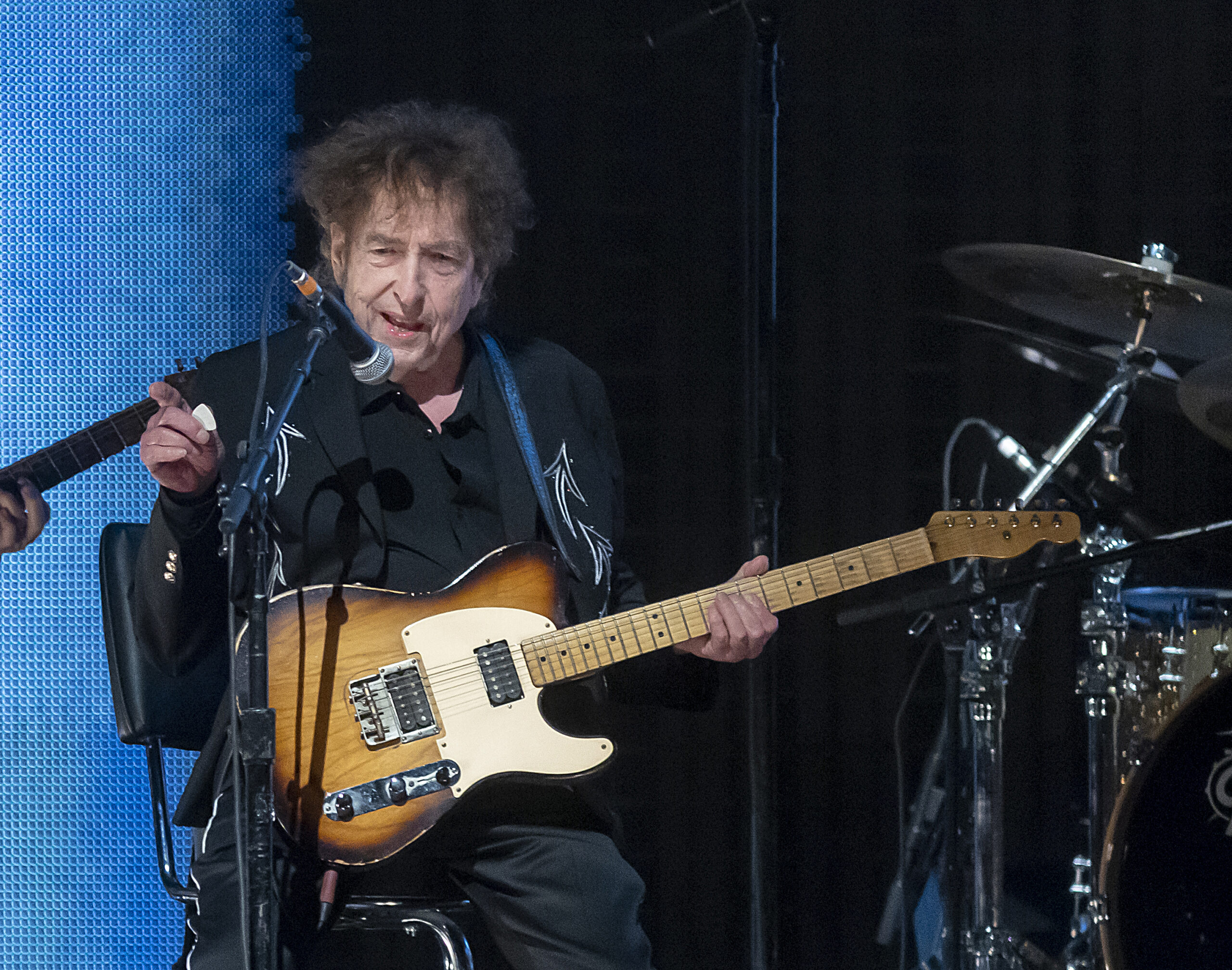Pearl Jam
Yield
Nach jahrelangen Querelen arbeiteten Pearl Jam an einem zweiten „Ten“. Das Ergebnis klang unentschlossen
Das fünfte Album der Band gilt als ihr Türöffner. Nicht als Türöffner für sie, sondern als Türöffner für uns. Wir sollten rein, sie zogen uns rein. Eddie Vedder war nun nicht mehr so grüblerisch, negativ, drohend. In der ersten Single des Vorgänger-Albums „No Code“ (1996), „Who You Are“, versuchten die Musiker bereits, ihre Hörer, wie heute alle sagen, „abzuholen“, sich Sinnfragen gemeinsam zu stellen: „Come to send not condescend / Transcendental consequences to transcend… Where we are…Who are we? Who we are…“ (man kann die tiefen Gedanken auch ignorieren und das Lied als das bezeichnen, was es auf jeden Fall ist: Das Wortspiel als Hommage an Vedders Lieblinge The Who).
Die „Yield“-Vorabsingle „Given To Fly“ ist einer schönsten Pearl-Jam-Songs und aus dem Stand einer der größten Fan-Favoriten geworden. Vielleicht, weil das Lied von Aufopferung ohne Anklage erzählt: „And he still gives his love, he just gives it away / The love he receives is the love that is saved“. Die Jesus-Figur wird ermordet, aber es ist eine Erlösung: „And sometimes is seen a strange spot in the sky / A human being that was given to fly“.
Dies war eine neue Art für den 34-Jährigen Vedder, mit dem Druck umzugehen: Wir können scheitern, aber wir tun es zumindest nicht für uns, sondern für euch.
Und Druck hatten Pearl Jam 1999 genug. Während der „No Code“-Aufnahmen kam es zu Konflikten, die Band-Hierarchie wurde neu ausgehandelt. Eddie Vedder stand alleine gegen jene drei, die Pearl Jam überhaupt gründeten: Jeff Ament, Stone Gossard und Mike McCready. Neu-Schlagzeuger Jack Irons, der, einer Anekdote zufolge, den Platz vor dem Mikro einst für Vedder überhaupt freigemacht hatte, war ohne Lobby.
„No Code“ verkaufte sich schlechter als der Vorgänger „Vitalogy“ (1994), der sich wiederum schlechter als dessen Vorgänger „Vs.“ (1993) verkauft hatte. Dazu neue logistische Probleme, vor Publikum aufzutreten. Durch den Streit mit Ticketmaster musste die Band an den entlegensten Orten spielen, Felder und Basketballplätze, alles andere stand bei dem Konzertkarten-Monopolisten unter Vertrag. Und das Zeitalter der Grunge-Bands war 1998 sowieso vorbei. Wer 20 Jahre später darauf zurückblickt, erkennt eine orientierungslose Phase in der Rockmusik. Sogar die Smashing Pumpkins machten nun Gothic Pop, und das meistbeachtete Album jener Zeit hieß „Mechanical Animals“ und stammte vom Clown Marilyn Manson.
„Yield“ wurde so zur ersten weichen Pearl-Jam-Platte, was natürlich bedeutete, dass wohlwollende Kritiker sie mit dem Debüt „Ten“ verglichen. Sie nannten die Songs „hymnisch“. Was eine andere Beschreibung war für Lieder ohne Brüche. Es war nicht zu überhören, dass die Band ihre entlaufenen Fans zurückhaben wollte.
Der Überfall-Opener
„Given To Fly“ begeisterte als Led-Zeppelin-Hommage, aber schon „Wishlist“ war jenes Generation-X-Tagebuch, das vor dem Beginn des neuen Jahrtausends längst durchgelesen war: „I wish I was a sailor with someone who waited for me.“ Es ist eine Kunst, Texte zu singen, die Teenager nachempfinden können, aber nicht so geschrieben sind, als wären sie von Teenagern. „Wishlist“ erschien eben gestrig.
Mit „Brain Of J“ präsentierte die Band jene Art Überfall-Opener, der zum PJ-Standard geworden ist, aber behäbig daherkommt, im Vergleich mit „Last Exit“ und „Go“ geradezu wackelt. Aber auch das Gespür für Längen ging auf dieser Platte verloren. „No Way“, als einziges der 13 Stücke ein Angriff auf Kritiker, dauert nur 4:25 Minuten, versandet aber bereits nach der Hälfte.
Drei Klassiker befinden sich auf „Yield“, neben „Given To Fly“ war das zum einen „Faithfull“. Wieder eine Led-Zep-Hommage, diesmal kommt Schlagzeuger Irons zur Geltung. In den vier Jahren als Bandmitglied entschleunigte er Pearl Jam, machte sie aber gleichzeitig härter. Mehr John Bonham als Keith Moon, gab er mit der Wucht seines Drummings schon Stücken wie „Smile“ oder „Hail, Hail“ eine Erdung, die sein verspielterer Vorgänger Dave Abbruzzese mit dessen Zig-Ziggedi-Zig vermissen ließ.
Mit „Do The Evolution“ wiederum haben die Musiker ihr bis heute auf Konzerten wohl beliebtestes Party-Lied aufgenommen, falls man hier überhaupt von einer Party sprechen möchte. Es war eine Freisetzung großer Energien, ein fiebriger Rundumschlag gegen Kriegstreiber und Herren der Schöpfung: „I’m at peace with my lust /I can kill ‚cause in god I trust, yeah /It’s evolution, baby“. Versetzt mit einem geisterhaften „Hallelujah“-Chor. Vielleicht das letzte wirklich zynische Lied von Pearl Jam.
Und die Band selbst, was hält sie heute von „Yield“? Die Musiker sind sicher zufrieden. Erst vor vier Jahren führten sie das Werk bei einem Konzert in voller Länge auf, erstmals seit Veröffentlichung. „Yield“ hat anscheinend lange in ihnen gearbeitet.