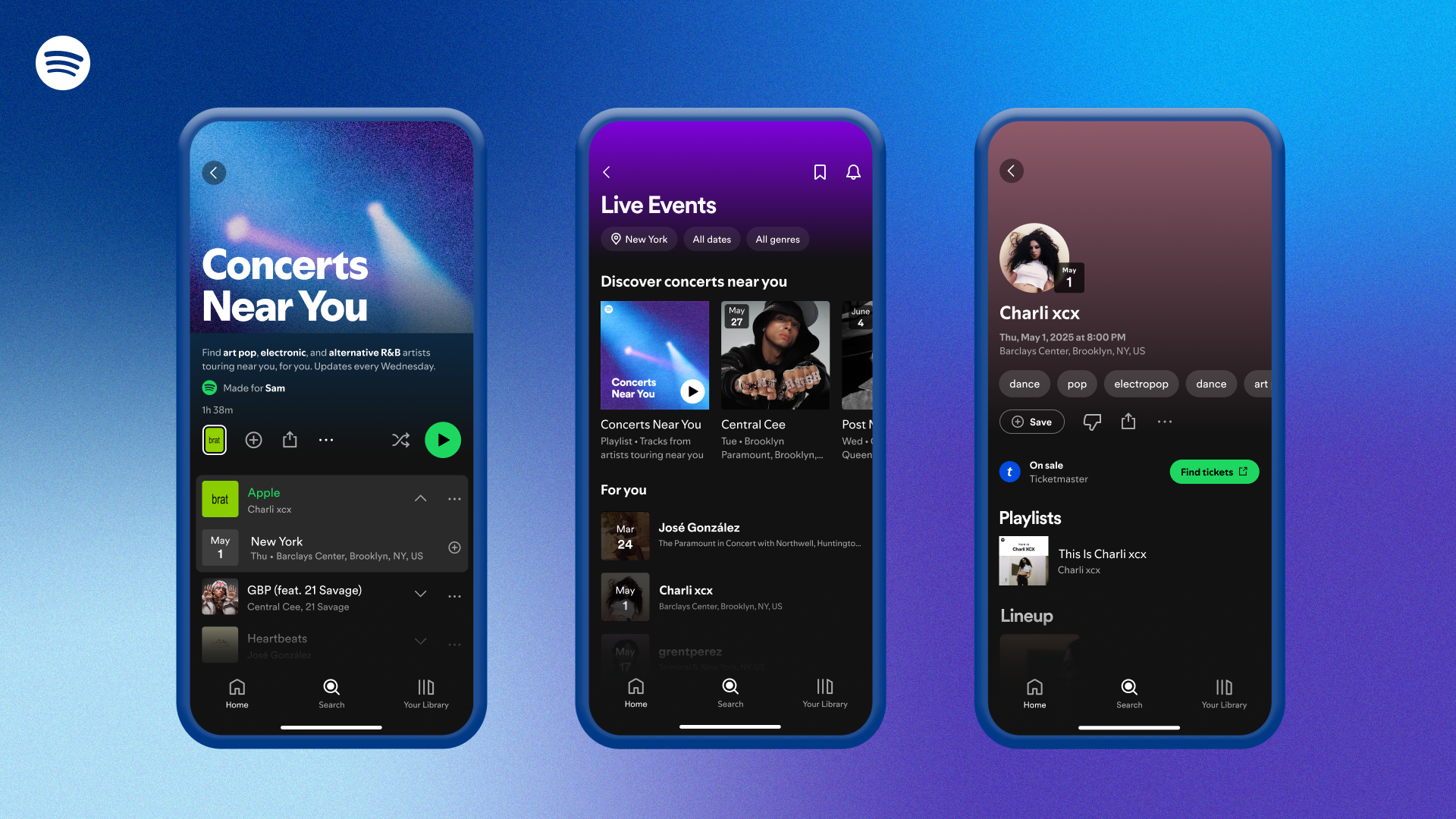Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump
Synthiepop war gestern. Die Welt hat sich verändert. DEPECHE MODE sind ernster und politischer als je zuvor. Auf ihrem neuen Album verhandeln sie Drohnenkriege, Fake News und soziale Ungerechtigkeit. Ein Gespräch in einem Café in New York, während draußen auf den Straßen Menschen gegen Trump demonstrieren. Die ROLLING-STONE-Titelgeschichte vom März 2017.
Aus ROLLING STONE, März 2017

Er hat das Café eben erst betreten, schon fragt Dave Gahan: „Hätte ich mir Sorgen um Sie machen sollen?“ Er lächelt. „Ihr Name klingt persisch“, erklärt der Sänger von Depeche Mode, dann nimmt er Platz. „Ich hatte meinen Manager vor diesem Termin gefragt: Lässt man ihn denn überhaupt noch in dieses Land?“
Willkommen in Trumps Amerika. Musiker machen sich Gedanken über das Einreiserecht von Journalisten, die mit ihnen sprechen wollen. In New York, Dave Gahans Wahlheimat. Am Tag zuvor fand unweit seiner Wohnung im Stadtteil Greenwich Village eine Demonstration statt. Tausende Menschen protestierten, wie überall in Amerika, gegen Donald Trump und sein Anti-Einreise-Dekret. Staatsangehörige aus sieben nahöstlichen und afrikanischen, muslimisch geprägten Ländern dürfen bis auf Weiteres nicht mehr in die USA. Gahan muss lachen, aber er lacht wie jemand, der schlicht fassungslos ist. „Ich habe diese Stadt dafür geliebt, dass sie so kosmopolitisch ist wie keine andere.“ Und nun habe man einen Präsidenten, der Menschen aus anderen Ländern pauschal verurteilt. Gahan betont jede Silbe: „Trump bezeichnet sich wirklich noch als NEW-YOR-KER?“
Seit gut 20 Jahren lebt Gahan in Manhattan. Das Caffe Dante liegt in Laufweite seiner Wohnung, es ist voll, die Kaffeemaschine zischt, niemand beachtet den britischen Popstar und den deutschen Reporter mit dem persischen Namen.
Früher aß hier Ernest Hemingway, später Robert Mapplethorpe und Patti Smith. „Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, sagt Gahan und deutet auf das eingerahmte Foto an einer Wand. Das Bild zeigt den ehemaligen Besitzer, Mario Flotta sen., der das italienische Café mehr als 40 Jahre lang führte, bevor er es schließlich an neue Eigentümer verkaufte.
Gahan bestellt Kaffee.
„Die Erde wird auch weiter existieren, wenn es uns alle nicht mehr gibt“
„Acht Jahre lang bemühte Obama sich um Annäherung an Länder des Nahes Ostens“, sagt er dann unvermittelt. „Und Trump wischt das alles mit einem Mal weg. Aber die Erde wird auch weiter existieren, wenn es uns alle nicht mehr gibt.“
„Ich könnte mir vorstellen, dass noch einiges über ihn ans Tageslicht kommt“, führt der Sänger aus und faltet die Hände. „Es würde mich auch nicht wundern, wenn schließlich ein Amtsenthebungsverfahren angestrengt wird. Some business is gonna rear its ugly head, irgendein Geschäft, das gegen die Verfassung verstößt. Gott sei Dank haben wir Gerichte, die einige von Trumps Dekreten und Gesetzen aufheben können. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass in den nächsten vier Jahren unter diesem Präsidenten nichts Sinnvolles geschehen wird.“ Seine Band, nimmt Gahan die Antwort auf die von ihm erwartete Nachfrage vorweg, könne auf dieses Chaos keine Antworten anbieten. Nur ein paar neue Ideen.

„We are not there yet“, mit dieser Zeile eröffnet Dave Gahan das neue Depeche-Mode-Album, „Spirit“. „Going Backwards“ heißt der harsche Song, er erzählt die Geschichte eines Drohnenangriffs. „We can track it all on satellite/ Watch men dying in real time/ We’re feeling nothing inside.“ Im Refrain konstatiert Gahan, dass die Zivilisation in ihrer Entwicklung rückwärtsschreite, bis sie irgendwann an ihrer „Höhlenmenschen-mentalität“ zugrunde gehe. „Zählen wir eigentlich noch die Opfer?“, fragt der Sänger.
„Going Backwards“ ist vielleicht genau der Schock, den wir brauchen. Der Song, der diesem Über-uns-nur-der-Himmel-Gefühl der Vorgängeralben „Sounds Of The Universe“ (2009) und „Delta Machine“ (2013) ein Ende setzt. Nie waren Depeche Mode politischer als heute, im 38. Jahr ihres Bestehens. „Wir sind darauf vorbereitet“, sagt Gahan, „dass Fans und Kritiker uns dieses Mal sehr viele Fragen stellen.“
Depeche Mode: Botschaften für die Masse
Seit Depeche Mode den Status als niedliche Synthiepopband Anfang der 80er-Jahre aufgaben, pflegt die Band ein düster-melancholisches Image, versteht sie ihre Songs gern auch als Botschaften – manchmal ironisch gebrochen, oft aber auch in einem feierlichen Ernst. Und je größer Depeche Mode wurden, desto größer wurde auch ihr Bewusstsein für das stetig wachsende Publikum, das ihre Botschaften begierig aufnahm. „Music For The Masses“ hieß 1987 ein Album, mit dem sie ihren Superstarstatus vorempfanden, den sie ein Jahr später, nach ihrer großen Welttournee, erreichten.
Mit „Sounds Of The Universe“ steckten sich die vier Briten 2009 ein noch höheres Ziel, sie schichteten einen dröhnenden Retro-Synthie-Sound über den anderen, bis man glaubte, gleich hebe ein nur aus Klängen bestehender Satellit zur Erkundung des Alls ab. Depeche Mode hatten abgehoben. Sie spielten in Deutschlands größten Stadien.
Der Satellit hat das All inzwischen verlassen und ist auf der Erde gelandet. Hier ist es weniger weihevoll.
Dave Gahan beugt sich über seine Kaffeetasse. Briten, so sei ihm aufgefallen, würden in New York wieder stärker wahrgenommen. Zumindest sprächen ihn Taxifahrer auf den Brexit an, und er müsse sich erklären – „dabei hatte ich erst zu Weihnachten diese Diskussionen, als ich bei meiner Familie in England war. Fast alle meine Leute hatten für den Ausstieg Großbritanniens aus der EU gestimmt. Unglaublich!“ Die Welt, sagt Gahan, werde immer kleiner, nicht größer, alle klammerten sich an ihren vermeintlichen Nationalstolz, dem eben gerade nicht Stolz zugrunde liege, sondern Angst.

Angst ist ein Leitthema des neuen Albums. In „Eternal“ erzählt Martin Gore, Instrumentalist, erster Songschreiber und zweiter Sänger der Band, vom Ende der Welt, von „schwarzen Wolken“ und radioaktiver Strahlung. Ein Song wie aus dem Kalten Krieg, Zeilen, wie man sie von Depeche Mode zuletzt in den 80er-Jahren gehört hat.
Was hat es denn eigentlich mit dem „Spirit“ des Plattentitels auf sich, welcher Geist wird da beschworen? „We failed/ It’s shameful/ Our standards are sinking/ Our spirit has gone“, singt Gore. „Genau deshalb“, sagt Gahan und hebt zu einer kurzen semiphilosophischen Abschweifung an, „fragen wir euch: Wo ist euer Spirit hin?“ Jeder könne sich zwar mit einem bestimmten Gefühl, einem „Spirit“, identifizieren und sich über die Liebe zu Kunst, Musik, Film einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. „Doch die Seele, ihr Inhalt, ist nicht greifbar. Und das macht uns allen Angst.“
Get on board!
Eine politische Band waren Depeche Mode nie, und man darf von ihrem Sänger keine scharfen politischen Analysen erwarten. Aber die Politik und wie sie die Welt verändert, beschäftigt ihn mehr denn je. „The Worst Crime“ verhandelt die Desinformation durch Fake News und Hetze in sozialen Netzwerken. Eine freie, unabhängige Presse werde immer wichtiger, sagt Gahan. „Ich gehe auf die Bühne und unterhalte die Leute, meine Texte dürfen reine Fantasy sein. Aber Sie“, er zeigt auf mich, „Sie müssen die Wahrheit schreiben!“
„Where’s The Revolution“, die Vorabsingle zu „Spirit“, verblüfft zunächst mit einem Titel, der auf das Fragezeichen verzichtet – als wäre alles schon längst verloren. Aber das Stück endet mit einem hoffnungsvollen Mantra, das fast wie eine bürgerrechtsbewegte Parole von Curtis Mayfield klingt: „There’s a train coming/ Get on board.“ „Revolution!“, sagt Gahan, dieses Mal mit Ausrufezeichen, sodass der Kaffee in seiner Tasse sanfte Wellen schlägt. „Love and peace. Das wollte schon John Lennon.“ Das sagt er ohne Lachen.
Hierzulande kommt keiner, der sich für Depeche Mode interessiert, an der zur Anekdote gereiften Beurteilung des Poptheoretikers Diedrich Diederichsen vorbei, der die vier aus Basildon 1981 in der Zeitschrift „Sounds“ als „simple Vorstadtkids“ mit „zwei nicht sonderlich aufregenden Singles“ beschrieb. Sein Fazit: Sind bald weg vom Fenster. Aus heutiger Sicht eine lustige Fehldiagnose.
Tatsächlich aber boten Depeche Mode in ihren Schulterpolsterjacketts und ihren auftoupierten Haaren zur Zeit ihres Debütalbums, „Speak & Spell“, wirklich nicht mehr als netten Synthiespaß, weit entfernt von den großen Popwerken, die andere Künstler zur gleichen Zeit schufen: Kraftwerk mit „Computerwelt“, The Human League mit „Dare“, Grace Jones mit „Nightclubbing“, Japan mit „Tin Drum“ oder Prince, der auf „Controversy“ mit lediglich einem Drumcomputer komplexe Arrangements erschuf – selbst der halbstarke Gary Numan war weiter.
Erst mit dem Abgang des Gründungsmitglieds Vince Clarke, der dann mit Yazoo den überzeugenderen Sythiepop machte, und dem dritten Depeche-Mode-Album, „Construction Time Again“ (1983), nutzte Songwriter Martin Gore sein Talent, süchtig machende Melodien mit harter Rhythmik und einer Botschaft zu verknüpfen. „Everything Counts“ war Kapitalismuskritik zum Tanzen: „The grabbing hands/ Grab all they can/ All for themselves.“ Zeilen, die heute aktueller klingen denn je. Zumindest scheinen sie aufgeladen mit aktueller Dringlichkeit, sodass die Band den Song bei der anstehenden „Global Spirit“-Tour spielen wird, zum ersten Mal seit zwölf Jahren.
„Martin fand die Idee zunächst nicht so gut“, erzählt Gahan. „Aber ich bestand darauf, diesen Klassiker auszugraben.“ Vielleicht auch weil „Everything Counts“ einen Bogen zu „Poorman“ vom aktuellen Album schlägt, das von Verarmung und Obdachlosigkeit handelt: „Companies get the grapes/ Keeping almost everything for themselves.“
„Everything Counts“ markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Band. In Deutschland wurden Depeche Mode damals immer größer, in England nahm das Interesse eher ab. Die vormals niedlichen Elektropopper entwickelten sich zu Stars und ihr Sänger endlich zu einem Performer. „Like Mick Jagger fronting Kraftwerk“, urteilte das „Q“-Magazin; in Osteuropa gibt es bis heute „Dancing Dave“-Wettbewerbe. Auch seine drei Kollegen Gore, Andrew Fletcher und Alan Wilder taten hinter ihren Maschinen alles, um aufzufallen. Ihre Rhythmen wurden vielschichtiger und wuchtiger zugleich, die drei Keyboarder nutzten gern auch mal Metallrohre, Fahrradreifen und Wellbleche.

1984 veröffentlichten Depeche Mode „People Are People“, ihren ersten Nummer-eins-Hit in Deutschland. Das Video zeigte Aufnahmen eines Kriegsschiffs, die ARD nutzte das Stück als Titelmelodie für die Übertragungen der Olympischen Sommerspiele. Die Botschaft war denkbar einfach: Alle Menschen sind gleich. Vielleicht steht „People Are People“ auch deshalb seit nunmehr 30 Jahren bei Martin Gore auf der schwarzen Liste. Und auch bei der kommenden Tour wird es wohl nicht zur Aufführung gebracht, wie Gahan verrät.
Dafür kann sich die Band bis heute mit einem anderen ihrer Klassiker identifizieren: dem im selben Jahr veröffentlichten „Master And Servant“, als sie Ketten, Leder und Bondage entdeckte. Martin Gore ging seinerzeit in Frauenkleidern auf die Bühne. Was nicht jedem gefiel – manche Kritiker unterstellten ihm billige Provokation, geistlose Kostümierung, Schwulenexploitation: Der ist ja gar nicht schwul, der tut nur so! Die 80er-Jahre konnten verdammt spießig sein. Denn Gores Aufzug war keine „Charleys Tante“-Albernheit, es war ein Rollenspiel, eine Erkundung. Und die dauert bis heute an.
Martin Gore, mittlerweile 55, schreibt noch immer Texte, die sich mit der Adoleszenz und dem Finden der sexuellen Identität befassen. Damals sang er: „Her first boy, his first girl/ Makes a change/ In a world full of nothing.“ Heute singt er: „The sun and the moon and the stars in the sky are laughing.“ Kein anderer 55‑Jähriger kann die Gefühlswelt Heranwachsender besser in Synthiepopzeilen bringen: Die ganze Welt lacht dich aus!
Und Gore ist es auch, der jenen zum Synonym für Depeche Mode gewordenen „Synthiepop“ immer wieder entscheidend weitet. Da wird aus Hähnen tropfendes Wasser zum Rhythmus („Nothing“), da klingt das tonlose Luftgeräusch eines Akkordeons wie lustvolles Stöhnen („I Want You Now“), oder die Bandmitglieder trampeln auf Koffern herum, woraus ihr berühmtester Beat entstand, nämlich der von „Personal Jesus“. Ergänzt durch hymnenhafte Refrains war der Weg an die Spitze der Charts quasi vorgezeichnet.
Mit den Alben „Violator“ (1990) und dem Nachfolger, „Songs Of Faith And Devotion“ (1993), hatten Depeche Mode dann tatsächlich alles erreicht, was man als richtig große Band so erreichen kann: Nummer eins überall in Europa und auch in den USA, Tourneen, die durch Stadien führten und aufgrund der Nachfrage über ein Jahr dauerten.
Depeche Mode: ab 1990 kam der Welt-Ruhm
Vielleicht ist es nicht nur ihre erfolgreichste, sondern auch ihre kreativste Phase. Das wundervoll einfache „Enjoy The Silence“ zeugt davon, ein Liebeslied mit einer Melodie so klar, als hätte die Band sie aus der Luft gepickt. Oder das stampfende „I Feel You“ und das pathetische „Walking In My Shoes“. Martin Gore hängte sich eine Gitarre um, Alan Wilder setzte sich hinter das Schlagzeug (er gab sein Bestes), Dave Gahan, der mittlerweile in Los Angeles lebte, trug Vollbart, lange Haare und sah sich als eine Art Straßenprediger. Sie schlüpften in eine neue Rolle: Rockband. Sie reagierten auf Grunge, was vor allem Gahan Anfang der 90er-Jahre faszinierte.
Und wie das im Rock’n’Roll so ist, ließ der Absturz nicht lange auf sich warten. Er geschah während ihrer Welttournee 1994. In Santiago de Chile hatte Gahan, kurz bevor er auf die Bühne ging, von Kurt Cobains Selbstmord erfahren. „Ich war angepisst“, kommentierte Gahan damals. „Weil Kurt mir zuvorkam“. Stattdessen erlitt er einen Herzinfarkt. Gore hatte Alkoholprobleme, Andrew Fletcher verabschiedete sich nach Nervenzusammenbrüchen vorzeitig von der Konzertreise – „Fletch“, der zumindest auf Fotos stets derjenige gewesen war, der am häufigsten lachte, wirkte fortan wie versteinert. Alan Wilder verließ die Band für immer.
Depeche Mode war nicht zerbrochen, aber am Ende. Und Dave Gahan verabreichte sich einen Speedball, einen Kokain-Heroin-Mix, der ihn für zwei Minuten ins Jenseits schickte. Gahan spricht heute nicht mehr von einer Nahtoderfahrung, sondern davon, dass er tatsächlich tot war. Er sagt: „Als ich tot war …“ In den vergangenen Jahren hat Gahan oft über jene 120 Sekunden Auszeit gesprochen: von der „Schwärze“, von der „gewaltigen Stimme“, von dem „enthusiastischen Gefühl“. Und seit er clean ist und 2009 auch die Entfernung eines bösartigen Blasentumors überstand, gilt Gahan als „lucky survivor“.
„Ich bin froh, dass ich noch lebe“
Jetzt, in dem Café in Manhattan, in seinem Kaffee rührend, sieht der 54‑Jährige einfach toll aus. Grau meliert (nur der Bart, nicht das Haar), scharfe Gesichtszüge und die roten, kantigen, hervorstehenden Fingerknöchel eines Boxers. Gahans Augen werden zu Schlitzen, sobald er sein wölfisches Lächeln zeigt, bei dem er eine Reihe unbehandelter Zähne entblößt. Er macht den Eindruck eines Menschen, der sich jeden Tag aufs Neue überreden lassen muss, vor dem Ausgehen überhaupt ein T‑Shirt anzuziehen. Er atmet aus vollen Brustzügen.
Über seine schlimmen Jahre Mitte der 90er wandert er im Gespräch mit wenigen Sätzen hinweg. „Ich trug meine Kämpfe mit dem Sensenmann aus“, sagt Gahan gelassen. „Ob durch meine Fehler, Drogen oder Alkohol. Oder eben durch den Krebs, den ich mir nicht aussuchte.“ Schnell sei es bergab mit ihm gegangen, erzählt er, mühsam sei er wieder ans Tageslicht gekrochen. „Ich bin froh, dass ich noch lebe.“
Die Geburt des Songwriters Gahan
Mit Gahans Rückkehr aus der Reha kehrten auch Depeche Mode 1997 als Trio zurück und veröffentlichten mit „Ultra“ ihr Comeback-Album, nachdem es zunächst geheißen hatte, Martin Gore habe aus Verzweiflung über den Absturz seines Sängers, der innerhalb von Wochen nur eine einzige Aufnahme hinbekam, die Sessions zu einer Soloplatte verarbeiten wollen.
Die viel zitierte Rollenaufteilung – Gore schreibt die Songs, Gahan macht die Show, Fletcher kümmert sich ums Geschäft – wurde erst im vergangenen Jahrzehnt aufgebrochen. Seit „Playing The Angel“ von 2005 steuert der Frontmann zwei bis drei eigene Stücke pro Platte bei, die er mit seinem Songwritingpartner, dem Schweizer Produzenten Kurt Uenala, schreibt. Und auf dem neuen Album ist Gahan tatsächlich gelungen, was sich Fans der Band nie vorstellen konnten: Nicht Gore, sondern Gahan liefert den besten Song einer Depeche-Mode-Platte. „Cover Me“ ist ein ätherischer, von einer Hawaiigitarre und viel Hall getragener Song über zwei Liebende, die aus ihrem Leben ausbrechen wollen; seine Melodie legt einen dramatischen Gangwechsel ein, und er endet in einem langen instrumentalen Outro.
Das Lob überrascht ihn nicht. Aber er freut sich.
Dave Gahan hat im neuen Jahrtausend mit „Paper Monsters“ und „Hourglass“ zwei Soloalben veröffentlicht, außerdem zwei Werke mit den Soulsavers, einem Projekt mit dem Electroproduzenten Rich Machin. Doch man schätzt ihn nicht unbedingt wegen seiner eigenen Lieder, sondern wegen jener seines Depeche-Mode-Kollegen Martin Gore, die Gahan singt. Gahan weiß das einzuordnen.
Er nähert sich Gores Texten seit mehr als drei Jahrzehnten immer auf dieselbe Weise an. „Wir besprechen die Inhalte“, sagt er. „Dabei frage ich mich: Kann ich hinter seinem Text stehen, oder behandelt der nur Martins Sichtweise? Ich muss schließlich später unsere Zuhörer überzeugen können.“
Gore und Gahan führen lange Diskussionen über die einzelnen Songs; auch darüber, wer sie singt. „Enjoy The Silence“ war 1989 als reduzierter Harmoniumsong erdacht, mit Gore als Interpreten. Ihr Arrangeur Alan Wilder aber erkannte das Potenzial, legte einen schnellen Rhythmus darunter – und schon übernahm Gahan das Stück. Eine gute Entscheidung. Der Rest ist Geschichte.
„ ‚Enjoy The Silence‘ ist perfekt“, sagt Gahan. „Es gibt darin nur Andeutungen, es geht um Wärme, Geborgenheit, um ein Glücksgefühl für die Ewigkeit.“ Er hält zwei Finger hoch: „Alles drin: erstens Melodie, zweitens Inhalt.“ Ein dritter Finger reckt sich. „Und was nicht zuletzt wichtig ist: der Sänger.“ Dann grinst er. Nicht nur weil die Pointe funktioniert hat. Sondern weil er weiß, dass es stimmt.

„Natürlich haben Martin und ich unsere Spannungen“, gibt Gahan zu. „Ich möchte unsere Partnerschaft nicht auf die Ebene von Giganten wie Jagger und Richards, Page und Plant oder Daltrey und Townshend stellen. Aber was haben diese Duos gemein? Reibungen, aus denen Großes entsteht.“ Dann zitiert Gahan den The-Clash-Sänger Joe Strummer. Auf die Frage, was der größte Fehler seiner Karriere gewesen sei, habe der geantwortet: „Mick Jones zu feuern. Dass ich mich überreden ließ zu glauben, ich bräuchte ihn nicht.“ Den Fehler würde Gore nicht machen, und Gahan auch nicht.
Vom Stadion zum Lounge-Pop und zurück
Ähnlich wichtig wie die mal schlechter, zuletzt aber immer besser funktionierende Zusammenarbeit der bei beiden Depeche-Mode-Köpfe ist die Wahl des Produzenten. Dabei lagen sie oft richtig, manchmal daneben. Die frühen Alben richtete ihr Entdecker ein, der genialische Mute-Labelchef Daniel Miller. Ab Mitte der 80er-Jahre übernahm Gareth Jones, der den Musikern in den Berliner Hansa Studios vor allem für „Some Great Reward“ (1984) einen industriellen, brachialen Sound verpasste.
Die Platte enthielt allerlei Werkzeugsamples, von denen Spötter behaupten, das seien übrig gebliebene Klänge aus den Sessions mit anderen von Jones’ Schützlingen – den Einstürzenden Neubauten. Für den nächsten Entwicklungssprung war Mark Ellis alias Flood verantwortlich: Er erschuf mit „Violator“ (1990) und „Songs Of Faith And Devotion“ (1993) jenes Klangvolumen, das später auch U2 für die Stadien fit machte.
Ab den Nullerjahren hinkte die Band, die sich nach Gahans langer Rehapause neu aufstellen musste, der Entwicklung elektronischer Musik etwas hinterher. „Exciter“ (2001), unter der Regie des mit den seinerzeit futuristischen Bleep- und Clong-Tönen bekannt gewordenen Electromusikers Mark Bell (LFO), war erschreckend zahmer Loungepop. Die letzten drei Platten wurden dann von dem Allroundproduzenten Ben Hillier (Blur, Doves, Elbow) verantwortet – und klangen eher nach Synthetik als nach Synthie, es mangelte ihnen an Wucht und Erotik. Auch der interessante Versuch in Electroblues, „Delta Machine“, führte Depeche Mode nicht aus der Sackgasse.
„BANG! Ich singe es in einem Take durch“
James Ford ist der Mann, der nun alles richten soll. Der Brite hatte als Mitglied von Simian Mobile Disco elegante Elektronik entworfen, als Produzent den tanzbaren Indiepunk der Arctic Monkeys Richtung Desert Rock geschoben. „James hat unseren Akku wieder aufgeladen“, erzählt Gahan. „Er versteht sich auf weiche, aber eben nicht klebrige Klänge, vor allem im Ambientbereich“. Ford habe der Band gezeigt, wann man Pausen in der Songdramatik brauche. „Auf wenigen unserer Alben gibt es so viel freien Raum wie auf ‚Spirit‘.“
Vor allem aber: Gahans Gesang überzeugt wie lange nicht. „Bevor ich einen Song aufnehme“, erzählt er, „knipse ich die Studiolichter aus, zünde eine Kerze an, überprüfe die Auswahl der Mikrofone“. Er spitzt den Mund, kneift die Augen zusammen, macht eine Kunstpause. „Und dann: BANG! Ich singe das Stück in einem Take durch.“ Dem folgen ein paar weitere, alles jeweils vollständige Aufnahmen des Songs, von Anfang bis Ende. „Welche Fassung James dann nimmt, will ich gar nicht mehr wissen.“

Am 17. März wird „Spirit“ veröffentlicht, im Mai startet die Tournee mit 34 Gigs in Europa, darunter neun Auftritte in Deutschland und der Schweiz. Wer heute elektronische Musik auf der Bühne aufführt, geriert sich gern minimalistisch: so wenige Geräte wie möglich, am liebsten nur Laptop und Computer. Auch Depeche Mode haben längst abgerüstet. Statt der pompösen Keyboardtürme der frühen Jahre gibt es seit den späten 90ern einen Tourschlagzeuger. Und einen großen Performer: Nach dem Tod von Prince und George Michael ist Gahan nun neben Bono wohl der letzte Sänger über 50, der auf der Bühne noch so jungenhaft und gestenreich auftritt wie ein Popstar der guten alten 80er-Jahre-Schule.
Aber das Programm ist aktuell: Natürlich werden die zwölf Songs des neuen Albums im Mittelpunkt stehen. „Wenn wir die nicht spielen wollten, bräuchten wir nicht auf Konzertreise zu gehen“, sagt Gahan, der Tourneen noch nie als Greatest-Hits-Revuen verstand. Die Arenen werden auch so voll.
Doch die Stars – die richtigen Stars – werden weniger. Während die Band „Spirit“ aufnahm, starb David Bowie. Er war nicht nur Gahans Vorbild, sondern auch sein Nachbar. Den Job bei Depeche Mode hatte der damals 18-jährige Ex-Autodieb bekommen, nachdem er bei der Audition „Heroes“ gesungen hatte. „Bowies Tod hat mir den Teppich unter den Füßen weggezogen“, erinnert sich Gahan. Sie wohnten unweit voneinander in Greenwich Village, ihre Töchter gingen auf dieselbe Highschool. „Wir grüßten uns, wir sahen uns bei Schulaufführungen. Ich wünschte nur, ich hätte ihn etwas besser gekannt. Er stand so oft vor mir und ich habe nichts gesagt.“ Irgendwann traf er den Nachbarn immer seltener, dann gar nicht mehr. Heute weiß er warum.
„Hab Dich auch lieb!“
„Pures Glück, dass ich noch lebe“, greift Gahan den früheren Gesprächsfaden wieder auf und schießt ein paar halbe Sätze im Stakkato raus: „It’s just roll of dice, man. So ist das Leben. Unerklärlich. Hätten wir eine Erklärung dafür, könnten wir auch Krebs heilen. So einfach ist das.“ Mit Schicksal, sagt er, hat sein Leben nichts zu tun.
Wir schweigen. Gahans Handy klingelt. „Hey, wie geht’s?“, ruft er ins Telefon. „Nein, wirklich? Das hättest du mal machen sollen! Ich komme gleich. Hab dich auch lieb!“ Und er legt auf. „Das war meine Tochter“, erklärt er. „Sie lief eben mit ihrem Freund am Café vorbei, sah uns hier sitzen und überlegte, reinzukommen. Sie hätte ruhig kurz Hallo sagen können …“
Gahan lächelt. Er lächelt, wie nur ein stolzer Vater lächeln kann. „Ich hatte die ganze Zeit über das Gefühl, sie sei in der Nähe. Das lag in der Luft, das habe ich gespürt!“ Spirit vielleicht. Dave Gahan steht auf, verabschiedet sich. Da draußen wartet sein Leben. Die Türklingel des Cafés läutet, Verkehrslärm zieht rein, der gut aussehende 54-Jährige taucht ab in den Straßentrubel seiner Stadt.
Abends im Hotel flimmert Trump über den Bildschirm. Im Pass des Reporters der Einreisestempel. Im Gepäck eine neue Platte von DDepeche Mode, die politischer ist als alle zuvor.