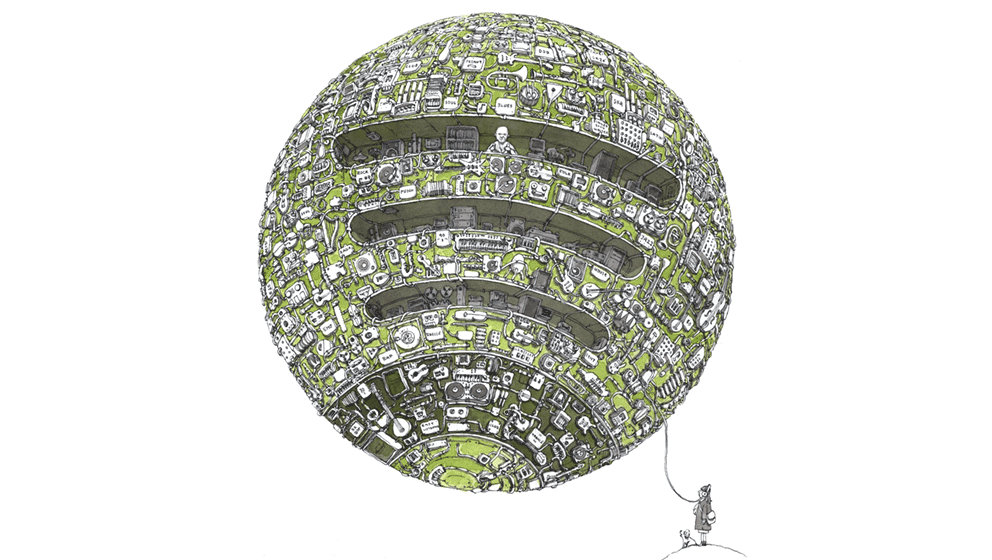So errechnet Spotify unseren Musikgeschmack
Mit ausgefeilten Algorithmen erkennt und bedient der Musikstreaming-Gigant Spotify unseren Musikgeschmack. Wie geht das – und wo führt es hin?
Wenn man früher verliebt war, hat man Mixtapes gebastelt. Darauf stellte man seine Lieblingslieder zusammen, die dann auch die Lieblingslieder der oder des Angebeteten werden sollten. Man wählte solche Songs aus, von denen man annahm, dass sie den Geschmack des anderen treffen – und hoffentlich sein Herz.
Heute machen Maschinen Mixtapes. Mit Liebe hat das wenig zu tun, trotzdem sind sie darauf aus, unser Herz zu treffen. Die Maschine, die für den Musikstreaming-Dienst Spotify Mixtapes bastelt, heißt Echo Nest. Sie ist in der Lage, anhand unseres Musikkonsums zu errechnen, welche dem Hörer bislang noch unbekannten Künstler ihm höchst wahrscheinlich gefallen werden. Und Spotify ist erschreckend gut darin, uns zu durchschauen.

Der Streaming-Anbieter wurde vor zehn Jahren als kleines Startup in Stockholm gegründet – und ist heute ein Branchengigant, in 55 Ländern per App oder Internet verfügbar, mit dem Musikangebot aller Majorlabels sowie zahlreicher Indiefirmen. Entweder gratis mit lästigen Werbeblöcken oder per kostenpflichtigem Abo ohne Reklame. 37 Prozent der deutschen Internetnutzer hören heute Musik über Streamingdienste, was etwa 20 Millionen Bundesbürgern entspricht.
Ich heirate meine Playlist
Spotifys größte Konkurrenten, Deezer und Apple Music, bieten mit Flow bzw. Beats 1 ebenfalls attraktive Playlist-Programme an, aber niemand vertraut so sehr auf Algorithmen wie Spotify. Dort bastelt man seinen Hörern individuelle, auf ihren Musikgeschmack zugeschnittene Playlisten: „Dein Mix der Woche“ (engl.: „Discover Weekly“), ein etwa zweistündiges Programm mit rund 30 Liedern, wird treuen Kunden seit 2015 jeden Montagmorgen frei Haus geliefert.

Schon jetzt nimmt die beliebte Funktion Einfluss auf den Musikmarkt: Über „Dein Mix der Woche“ wurden zum Beispiel Halsey und Lorde groß. Plattenfirmen versuchen regelmäßig, ihre Künstler in der Playlist unterzubringen – aber Spotify behauptet, ihre individualisierten Mixtapes blieben von den Begehrlichkeiten der Musikindustrie unbeeinflusst. Zu den Gerüchten, dass die Majorlabels fünf Prozent von Spotify besitzen, schweigt sich die Firma indes aus.
Die Nutzer juckt das nicht. Unter dem Hashtag #DiscoverWeekly überschlagen sie sich auf dem sozialen Netzwerk Twitter zu Beginn jeder Woche vor Lob.
Künstliche Intelligenz am Montagmorgen
Aber wie schafft es ein Algorithmus, den Geschmack der Nutzer zu treffen, sodass diese schon romantische Gefühle entwickeln? Mit ausgefeilter Technik. Ein bekannter Algorithmus ist etwa die manchmal alberne „Das könnte Sie auch interessieren“-Funktion bei Amazon. Sie beruht auf dem vergleichsweise simplen Prinzip des kollaborativen Filterns. Das bedeutet, dass der Algorithmus nach Nutzern sucht, die das gleiche Verhaltensmuster aufweisen wie man selbst, um daraus eine Vorhersage abzuleiten. Verglichen damit kann man Spotifys Algorithmus Echo Nest durchaus eine gewisse künstliche Intelligenz attestieren. „Dein Mix der Woche“ ist ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt: dem Musikgeschmack des Nutzers, der klanglichen Analyse der Musik sowie dem Durchforsten von Musikseiten.
„Wenn fünf Ihrer Lieblingssongs auf Playlisten anderer Hörer gehäuft mit einem Ihnen bisher unbekannten sechsten Song auftauchen, dann wird Ihnen der Algorithmus diesen sechsten Song wahrscheinlich in „Dein Mix der Woche“ vorschlagen.“
Schritt 1: Geschmacksprofil
Der Ausgangspunkt für den individuellen Mix ist das „Taste Profile“ eines jeden Nutzers, das anhand des Konsums erstellt und mit allen Abermillionen Songs der Datenbank abgeglichen wird. Man kann sich das so vorstellen: Wenn fünf Ihrer Lieblingssongs auf Playlisten anderer Hörer gehäuft mit einem Ihnen bisher unbekannten sechsten Song auftauchen, dann wird Ihnen der Algorithmus diesen sechsten Song wahrscheinlich in „Dein Mix der Woche“ vorschlagen.
Schritt 2: Klang-Analyse
Das zweite Tool ist der „Audio Scan“: Innerhalb von Millisekunden wird Musik in ihre Einzelteile zerlegt (unter anderem in Tonart, Instrumente, Höhen und Tiefen, Tempo, Klangfarbe). Eine Audiodatei wird auf Frequenzen heruntergebrochen, bis sie aus einem Haufen Zahlen besteht, die in einer Matrix gelistet sind. Diese Zahlenreihen zeigen zum Beispiel, in welchem Teil der Song am lautesten ist, wo die Note A auftaucht und wie oft. Im Prinzip funktioniert das ähnlich wie ein Stimmgerät für die Gitarre: Auch da erkennt der Rechner, ob die E-Saite gezupft wurde und ob sie verstimmt ist.
Klingt Liebeskummer eher „traurig“ oder eher „schwermütig“?
Im nächsten Schritt werden die noch nackten Zahlen mit Beschreibungen versehen, etwa „instrumental“ oder „vocal“ oder, schwieriger, „melancholisch“ im Gegensatz zu „traurig“. Ein diffiziles Terrain. Dabei helfen dem Technikhirn Millionen von Playlists, die Kunden erstellen und „Liebeskummer“ oder „Traurige Lieblingssongs“ nennen. Denn Spotify hat Zugriff auf diese Listen und kann feststellen, was an den Liedern eigentlich „schwermütig“ klingt. Echo Nest entscheidet schließlich, ob ein unbekanntes Lied „melancholisch“ oder „traurig“ ist – anhand bekannter Lieder, die ähnlich klingen.
Schritt 3: Texterkennung
Die dritte Komponente heißt Texterkennung: Echo Nest scannt etwa zehn Millionen Postings täglich und untersucht, wie sich Musikhörer im Internet auf Blogs, Twitter, Facebook oder in Magazinen über Musik äußern. Der Algorithmus wertet Begriffe aus und Kontexte, in denen ein neuer Künstler genannt wird. Dabei spielen positive Begriffe wie „Lieblings“ eine Rolle, oder wie oft eine bekannte Band als Vergleich angeführt wird. Je intensiver der Musikkonsum, desto treffsicherer die persönliche Liste – und desto mehr wird der Hörer an den Streamingdienst gebunden. Das kann man Big Data nennen – oder schlicht unheimlich.
„Echo Nest ist einzigartig, weil niemand so genau hinschaut wie wir – mit drei Komponenten gleichzeitig“
Einer der Erfinder von Echo Nest ist Brian Whitman, ein urfreundlicher Amerikaner mit Vieletagebart und Holzfällerhemd. Seit Spotify Echo Nest vor zwei Jahren für 100 Millionen Dollar kaufte, fungiert der Computerwissenschaftsdoktor dort als Chief Technology Officer. „Echo Nest ist einzigartig, weil niemand so genau hinschaut wie wir – mit drei Komponenten gleichzeitig“, sagt er.

Am Ende verteilt Echo Nest die Abermillionen Musikinformationen in eine Genrematrix. Sie heißt Echo Tree und ist ein weit verästeltes, gigantisches Schaubild, in dem derzeit 1.496 (!) vermeintliche und tatsächliche Genres zueinander in Beziehung stehen. Da gibt es kryptische Bezeichnungen wie „moombahton“, „oi“, „c64“ oder „nwothm“, das natürlich nicht zu verwechseln ist mit „nwobhm“. Begriffe wie „antiviral pop“ oder „grisly death metal“ lassen zumindest erraten, dass es sich um Musikrichtungen handelt.
Neben „Contemporary Country“ findet sich tatsächlich die Kategorie „Fußball“. Überhaupt muten die Verwandtschaften bisweilen kurios an. „Afrobeat“ und „Kindermusik“ etwa ähneln sich auf der X und der YAchse (für „bounci ness“ bzw. für „akustisch/organisch vs. elektronisch/mechanisch“). „German Pop“ ist verknüpft mit „Thai Pop“, und dass „Volksmusik“ direkt über „Deep Taiwanese Pop“ liegt, müsste man mal Helene Fischer melden. Wer wissen will, wie das klingt, kann eine Hörprobe sowie Infos zu jedem „Genre“ anklicken. Natürlich ist das alles ein ziemlich interessanter Irrsinn. Und er scheint in seiner eigenartigen Algorithmuslogik zu funktionieren.
„Immer wenn eine neue Band auftaucht, die in ihrer Facebook-Biografie oder in einer Rezension als ‚Shoegaze‘ bezeichnet wird, ist das ein Hinweis auf ihre mögliche ‚Shoegazeness‘ “, erklärt Whitman. „Und wenn irgendwo ‚Shoegaze‘ thematisiert wird, ist meistens von My Bloody Valentine die Rede. Solch eine Information hilft uns zu verstehen, was ‚Shoegaze‘ ist. Dieser Musikstil hat einen gewissen Sound. Bands können ihn verändern, aber du erkennst einen Shoegaze-Song, wenn du ihn hörst.“
„Ich möchte nicht, dass sich eine reduzierte, leicht vermittelbare Version einer bloßen Laune bei mir anbiedert“
Der Musikkritiker Ben Ratliff hat sich als einer der Ersten mit der schönen neuen Welt der Algorithmen befasst. In der Realität seien Gefühle paradox, sagt Ratliff, weshalb Algorithmen nur grobmotorisch auswählen können. Es gebe keine rein „melancholische“ Laune oder geschmeidige Kaffeehausstimmung. Dennoch fasziniere ihn die Treffsicherheit des „sophisticated“ Algorithmus von Spotify – auch wenn sich manche Vorschläge durchschaubar anfühlten. In seinem Buch „Every Song Ever: Twenty Ways To Listen In An Age of Musical Plenty“ beschreibt Ratliff die Veränderung des
Musikkonsums durch Überfluss und Digitalisierung. Das Hauptproblem: Neunmalkluge Playlists machen faul. Der passive Hörer kann sich musikalisch kaum weiterentwickeln. „Oft hasse ich die Ergebnisse, auch wenn ich die Hälfte der Lieder mag“, seufzt Ratliff. „Ich möchte nicht, dass sich eine reduzierte, leicht vermittelbare Version einer bloßen Laune bei mir anbiedert.“

Marcel Grobe, Pressesprecher von Spotify, verteidigt das System: „Früher im Plattenladen hat man auch zehn Alben angehört und mochte am Ende nur zwei. ‚Dein Mix der Woche‘ soll eine Empfehlung sein, ist aber nicht so konzipiert, dass man ihn stundenlang hört und alles gut findet.“ Zudem gebe es noch immer Musikredakteure, die von Hand und „mit Liebe“ Playlisten zusammenstellen. Im Berliner SpotifyBüro arbeiten aktuell vier Kuratoren, die deutschlandweit ungefähr 400 Listen erstellen, für jede erdenkliche Situation: fürs Joggen, das anschließende Duschen oder den Wohnungsputz.
Happy End?
Seit September steckt Spotify mit der Dating-App Tinder unter einer Decke, um das menschliche Balzverhalten musikalisch zu unterstützen. Ziel ist, den Spotify-Katalog des potenziellen Liebespartners mit seinem eigenen abzugleichen, getreu der Annahme: Wer dieselbe Musik mag, passt auch sonst gut zusammen. Vielleicht haben Algorithmen ja doch ein bisschen mit Liebe zu tun.