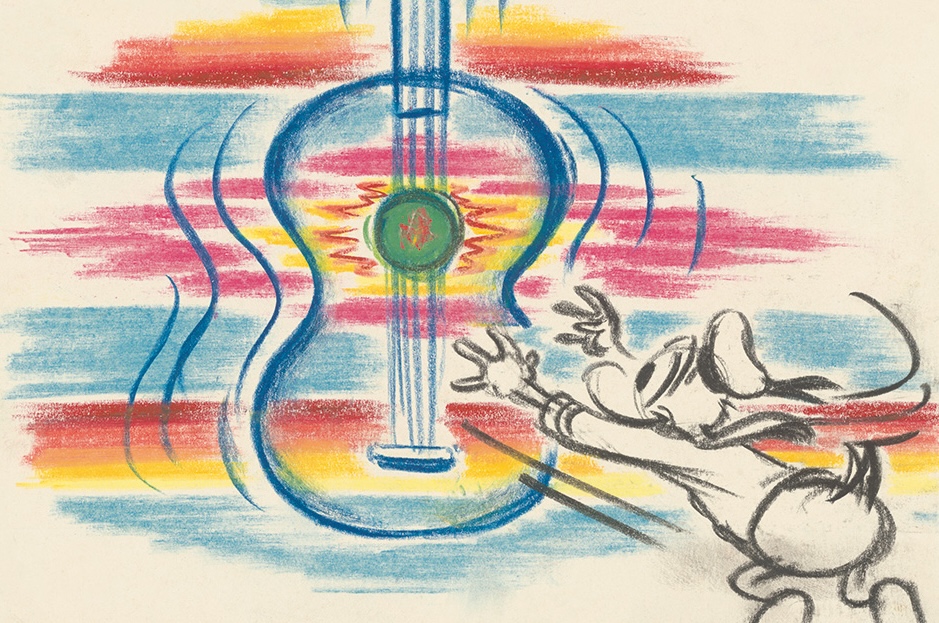„Lawrence von Arabien“: Wüst und leer
„Lawrence von Arabien“ ist ein monumentaler Film, der aber nur im Kino Sinn ergibt.
„Lawrence von Arabien“ ist ein Film über Zeit und Bewegung. Ein Historienschinken, der trotz seiner großen Bilder, trotz seiner Sehnsucht zu überwältigen, die psychische, ja auch die physische Entwicklung seiner Hauptfigur niemals außer acht lässt.
Wie klug, mit dem banalen Motorradunfalltod eines Mannes zu beginnen, von dem in fast vier Stunden gezeigt wird, wie er versucht, die Welt mit seinen erst filigranen, dann immer kräftiger zupackenden Händen nach seinen Vorstellungen zu gestalten.
Zwischenzeitlich fühlt sich dieser Thomas Edward Lawrence wie ein Messias, der sogar daran glaubt, übers Wasser gehen zu können. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass einer seiner Schützlinge (die ihm folgen wie Jünger) erbärmlich im Treibsand versinkt. Eine Szene, auf die kein Zuschauer vorbereitet sein kann. Genauso wenig wie auf den geradezu gewaltsamen Schnitt von brennendem Streichholz auf die aufgehende Wüstensonne und den Kamelreiter hinterm Horizont. Das Messer Buñuels. Der Knochen Kubricks.
Männerkino – Kino über Männer
Hier geht es nur um Männer, um das, was sie antreibt und vernichtet. Überleben. Frauen gibt es nur zweimal zu sehen: als Opfer eines Gemetzels und als Sanitäterinnen. Überraschend, wie Lawrence‘ homoerotische Begierden und auch seine sadomasochistischen Wunschvorstellungen, natürlich sublimiert über seinen Heiligenscheinkomplex, thematisiert werden. 1962!
Überraschend auch, wie geschmeidig das Drehbuch die Passion dieses Wüstensohns in fast vier Stunden ausbreiten kann, ohne dass der erzählerische Atem ins Stocken gerät. (Die Unterbrechung, die den Zuschauer nach etwas mehr als zwei Stunden erwartet, ist aber auch bitter nötig). Als Vorlage diente lediglich die Biographie „Die sieben Säulen der Weisheit“, die T.E. Lawrence, längst zum Helden geworden, aus dem Gedächtnis niederschrieb, nachdem ihm sämtliche Aufzeichnungen verlorenen gegangen waren.
Der Literaturkenner Lawrence – wie er immer wieder, vor allem von jenen Oberen gennant wird, die rauchend, trinkend, wispernd außerhalb der Theaterbühne stehen, um dann entsetzlich gedankenlos ins Geschehen einzugreifen, es nach ihren Gunsten zu verändern, als handelte es sich um eine Partie Schach. Natürlich alles Arbeit am Mythos.
Lawrence, der sich selbst als Intellektueller verstand, korrespondierte später mit allen Kulturgrößen Großbritanniens. Seine feine Zurückhaltung, aber auch den sprühenden Weltgeist legte Peter ‚O Toole allein in seine nuancierte Stimmlage, die er Lawrence verlieh. Eine Sanftheit, die seinen immer zielstrebigeren Taten zuwiderläuft.
Wahnsinn in der Wüste
„Lawrence von Arabien“ ist aber auch ein einziges Zuwiderlaufen. Dualismen und scheinbare Gegensätze quellen wie Wasser aus den zahlreichen Brunnen, die den an Hitze ersaufenden Protagonisten wie Rettungsanker erscheinen. Sie schwitzen aber nie. Nur im Furor steht ihnen der Schweiß auf der Stirn wie Lawrence der Wahnsinn im Gesicht, als er mit der Pistole in der Hand einen Türken nach dem nächsten niederstreckt.
Und dann ist da noch diese ungetümgroße, gleißende Wüste, ein amorpher Ort, wie wir seit Baudrillard wissen, bei dem jedes Sandkorn voller Symbolik ist. Fast zwei Stunden nichts als Ödnis, Sand, Trockenheit, Überlebenskampf. Eine Theaterbühne, wie sie sich Beckett sicher für seine Endspiele gewünscht hätte.





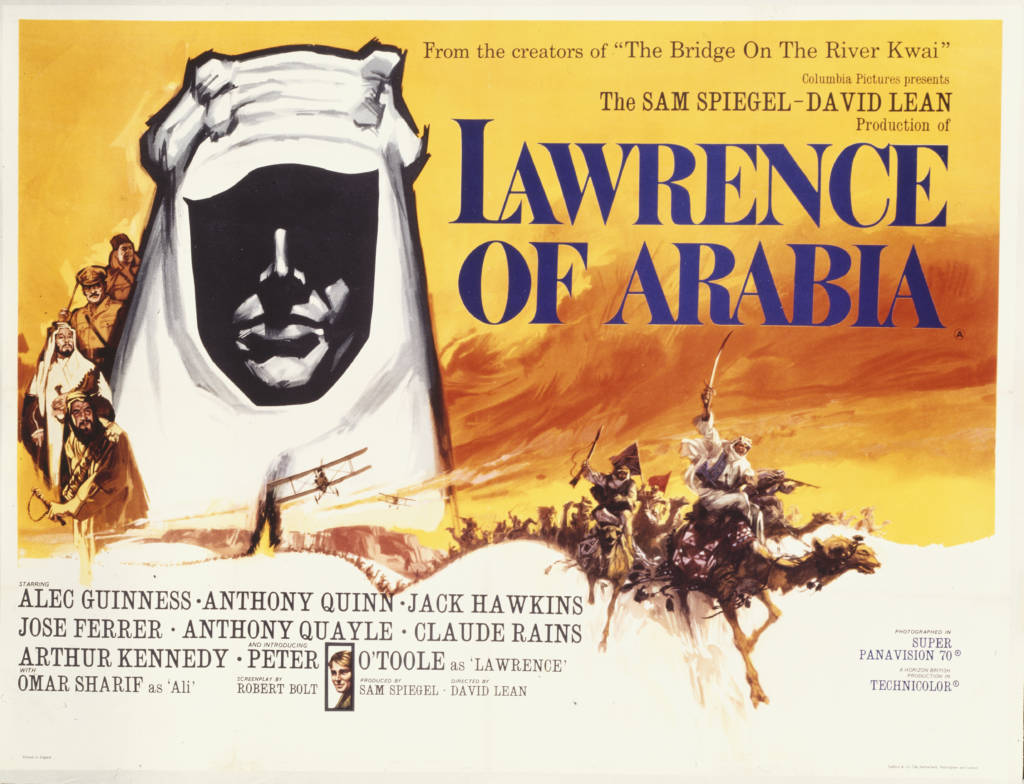
Folgen Sie dem Verfasser dieser Zeilen, wenn Sie mögen, auf Twitter, Facebook und auf seinem Blog („Melancholy Symphony“).