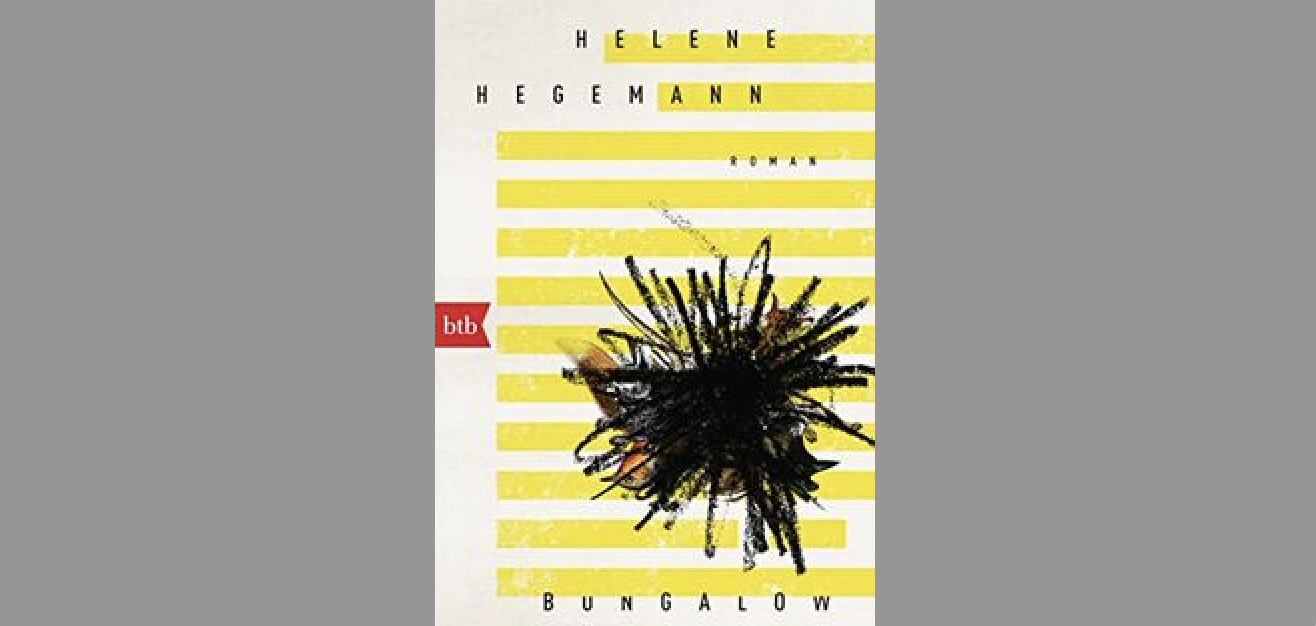15 Gedanken zu „Axolotl Overkill“ von Helene Hegemann
Endlich eine gelungene Literaturadaption mit Schmackes und einer Portion Größenwahn? Nicht ganz. „Axolotl Overkill“ hat ein großartiges aufgelegtes Darsteller-Ensemble, fiese Witze und einen feinen Blick auf Berlins Künstlerszenen zu bieten. Doch Helene Hegemann ging wohl doch etwas der Mut aus bei der filmischen Umsetzung ihres Romandebüts.

Empfehlungen der Redaktion
- Natürlich ist es ein Glücksfall für das deutsche Kino, dass Helene Hegemann ihr Buch „Axolotl Roadkill“ selbst verfilmt hat. Bestimmt hatten die Produzenten schon eine neue Version von David Wnendts „Feuchtgebiete“ im Kopf. Hätte gut werden können, oder aber auch eine Katastrophe – denn „Axolotl Roadkill“ hatte einen völlig anderen ideologischen Ansatz als Charlotte Roches Ekel-Revue.
- Klug ist, dass sich Hegemann nicht darauf verließ, einfach ihren Roman zu adaptieren. Stattdessen ersuchte sie die „Overkill“-Szenen des Buchs noch etwas zu vergrößern und um ein paar schöne Ideen zu ergänzen.
- Da ist zum Beispiel der Pinguin. Eine durchaus surreale Bildidee. Übrigens der einzige Film-Pinguin Deutschlands, der extra für den Dreh eingeflogen kam. Aber ist die Szene, in der das possierliche Tierchen durch die Wohnung watschelt nicht auch ohne Bezugspunkt, inhaltlich leer? Zusätzlich gibt es noch Alpakas und ein (etwas künstlich wirkendes) Einhorn. Aber hat das Bedeutung über die Symbolisierung von psychischen Zuständen der Hauptfigur hinaus? Eher nicht.
- Helene Hegemann hat es anscheinend darauf angelegt, so wenig Plot wie möglich zu konstruieren. Keine schlechte Idee, denn daran leidet der deutsche Film schon seit Jahren. Es folgt also eine unvermittelte Skizze nach der nächsten. Mifti im KZ-Sachsenhausen, Mifti im Taxi nach Nirgendwo, Mifti im Kampf mit ihrer hysterischen Schwester, Mifti im Nachtleben Berlins.
- So sehr die skizzenhaften Szenen überzeugen (manche wurden nur wegen eines schalen Witzes gedreht, man sieht es sofort), der größte Glücksfall ist die eindringliche Betrachtung des Berliner Nachtlebens mit ihren am Rande der Verzweiflung tänzelnden, vollgekoksten Kunst- und Künstlergestalten. Das war in der Deutlichkeit so bisher noch nie zu sehen. Helene Hegemann kennt sich aus. Natürlich werden auch all die Orte gezeigt, die sich die nicht immer ganz so bürgerliche Bohème erobert hat („Grill Royale“ und Co.). So entkommt „Axolotl Overkill“ ganz geschickt den gängigen Berlin-Film-Klischees.

Der heimliche Star des Films/Buchs - Überhaupt ist es schön, dass sich „Axolotl Overkill“ nicht eine Sekunde an den zwar durchaus spannenden, inzwischen aber auch schon etwas zu sehr in den Himmel gelobten Bildern aus „Oh Boy“ und „Victoria“ versucht. Dieses Berlin kennen wir ja jetzt. Allerdings bleibt der Film auch etwas brav, was die Ausgestaltung seiner vielen klugen Drehbucheinfälle angeht.
- Irgendwie wirkt „Axolotl Overkill“ mit seinen fragmentarischen Szenen, die in ihrer Verdichtung manchmal den Charme eines Comic-Strips ausstrahlen, trotz aller Raffinesse nicht die Spur experimentell, obwohl uns das doch suggeriert wird. Die Regisseurin Hegemann vertraut auf altbewährte Techniken, sie filmt ihre Figuren mit Ruhe – aber nicht mit brennender Neugierde. Die hibbelige Schwester Annika (natürlich: Laura Tonke) verkommt schnell zur Witzfigur, die zartbittere Erotik von Alice (Arly Jover) ist vielleicht an Godard angelegt, aber eben nur halbgekonnt und einfach nicht geheimnisvoll genug. Die im Feuilleton besprochene „Wohlstandsverwahrlosung“ ist schon da, aber gekokst und gehurt wird dann eben doch nur aus der Weitwinkelperspektive. Der natürlich großartige Soundtrack (man stellt sich gerne vor, dass er schon lange vor Drehstart feststand und wegen der hohen Lizenzgebühren einen nicht zu vernachlässigenden Teil des Budgets fraß; grandios ist der Einsatz von Gil Scott-Herons Meisterstück „Me And The Devil“) gehört zum Genre natürlich dazu und wird in der eklektischen Auswahl längst erwartet.
- Übrigens: Toll einmal zu sehen, was für eine großartige Schauspielerin Mavie Hörbiger ist. Hier als metareflexive Schauspieler-Persona mit Hang zum Absturz. Man wünscht ihr spontan noch viel größere, wahnsinnigere Rollen. Weniger „Bibi & Tina“ und „Tatort“ und dafür mehr Arthouse. Vielleicht sogar mal eine Hauptrolle in einem Film vonChristian Petzold. Wäre doch mal etwas.
- Natürlich geht das meiste Vergnügen von Jasna Fritzi Bauer aus, die schon aufgrund ihrer Körperlichkeit und ihres Sprachgestus’ die ideale Besetzung ist. Sie kiekst und grunzt und labert frei und sinnlos vor sich hin. Das wirkt jederzeit spontan und nicht wie aufgesagt. Da fällt in Deutschland fast keine zweite Schauspielerin auf, die ähnlich passen würde. Allerdings ist ihr Spiel auch oft arg routiniert „gegen den Strich“ und betont lolitahaft mit Knabencharme. Eine Erinnerung an „Ein Tick anders“ (in dem Bauer ein Mädchen mit Tourette-Syndrom spielt) reicht aus, um sich verwundert die Augen zu reiben, was möglich gewesen wäre. Man wundert sich auch, warum Hegemann mit der Kamera nicht öfter mal auf die Körper hält und so die Bezüge zur Nouvelle Vague und zum Mumblecore-Kino der US-Indies etwas zuspitzt. Manchmal sind die Frauen hier nackt. Warum auch nicht? Aber das wirkt alles spröde, nicht einmal authentisch „entblößt“.
- Ein Schuss Feminismus steckt ja in der Vorlage. Und sicherlich kann man nicht abstreiten, dass sich „Axolotl Overkill“ mit seiner freischwebenden, an keine Autoritäten und Grenzen gebundenen Hauptfigur als emanzipatorisches Manifest für ein Leben ohne „GNTM“, 1,0-Abi-Schnitt oder Ghetto-Credibility verstehen lässt. Wenn es denn wenigstens mehr Anhaltspunkte dafür gäbe, dass diese weibliche Odyssee durch eine gerade einmal entflochtene Jugend irgendwann einmal zu etwas führen könnte. Das können andere Film-Autorinnen besser: Kelly Reichardt, Andrea Arnold, Jill Soloway und natürlich auch Lena Dunham. Oder in Deutschland Pia Marais, Valeska Grisebach und natürlich auch Maren Ade.

Helene Hegemann (2010) mit ihrem skandalumwitterten Roman - Im Vergleich zum Buch, das im Grunde im Kopf von Mifti sitzt, ist diese Göre wesentlich geerdeter – und überraschend wenig ausdifferenziert. Was erfahren wir schon über Mifi? Was mag sie, was mag sie nicht? Wohin strebt sie im Leben? Dauernd hat sie ein Buch in der Hand (nie lässt sich mit Sicherheit sagen, von wem es ist), doch schon im nächsten Schnitt wirft sie es zur Seite. Die Pose des spontanen intellektuellen „Genusses“ scheint wichtiger zu sein als die Vertiefung in Gedanken.
- So verfährt auch der Film: Man kann ihn sich gut als einen postmodernen Reißer vorstellen, in dem Diskurse auseinandergepflügt werden. Klar, „Axolotl Overkill“ zeigt uns auch jene Erregungszustände, die für dieses “Genre“ kennzeichnend sind. Doch ehrlich gesagt sind die kulturkritischen Impulse lediglich zu satirischen Appercus erstarrt.
- Das kann hinreißend komisch sein! Zum Beispiel wenn der hyperpotente, reiche Vater seinen Töchtern erzählen möchte, dass Terrorist zu sein nur eine fantastische Möglichkeit ist, sich im Job zu verwirklichen; ein schöner Gag, der die gutbürgerliche Verklärung und Verwandlung sozialer Verfallszustände in ästhetische Kategorien entlarvt. Der trockene Humor von „Axolotl Overkill“ ist zuweilen eine echte Wonne.
- Es kann aber auch befremden, wenn die Autorität eines wirren Lehrers im KZ Sachsenhausen launig vernichtet wird, nur um Mifti später sagen zu lassen, dass es ja an einem Führer mangelt, um sich in die Pein der Vergangenheit wirklich einfühlen zu können. Immerhin ist die Szene die Steilvorlage für die lustigste Szene in einem Schuldirektor-Zimmer in der jüngeren deutschen Filmgeschichte. Und jetzt kommen sie nicht mit „Fack Ju Göhte“…
- Natürlich lässt sich „Axolotl Overkill“ noch am ehesten als etwas kratzbürstige Coming-Of-Age-Geschichte lesen. Zudem als Zusatzangebot für die Leser des Buches, die hier zwar eine ähnliche Struktur und viele bekannte Figuren bekommen – aber eben doch eine andere Story. Es ist aber auch Helene Hegemanns Versuch, sich als Performance-Künstlerin zu etablieren, die Kino beherrscht wie das Romanhandwerk. Ironisch ist allerdings, dass ausgerechnet ihr 2008 gedrehter Erstling „Torpedo“ (mit der beeindruckenden Alice Dwyer) wesentlich kunstsinniger und mutiger erscheint. Dabei handelte es sich doch um eine Fingerübung. Mehr Experiment hätte „Axolotl Overkill“ gut getan. Vielleicht wäre der Stoff sogar für eine TV-Serie wesentlich geeigneter gewesen. Eine Berliner Fassung von „Girls“. Das fehlt uns!
Dem Autor auf Twitter folgen:
Mehr News und Stories