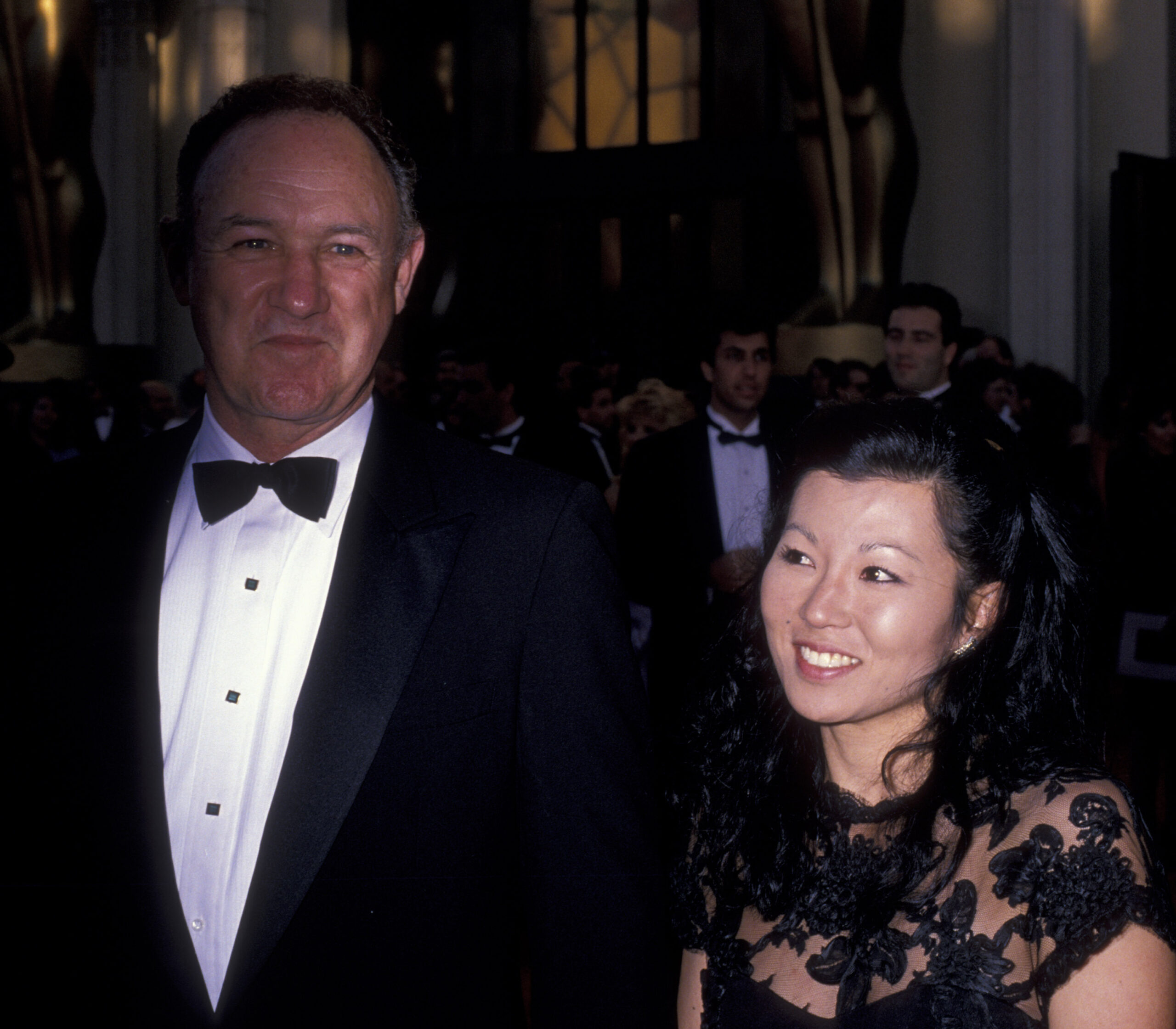Rewind Today: Pink Floyd veröffentlichen „The Wall“
Heute vor 35 Jahren veröffentlichten Pink Floyd mit "The Wall" die vielleicht ambitionierteste 'Rock-Oper' der Musikgeschichte. ROLLING STONE gratuliert und würdigt das bis heute unvergleichliche Meisterwerk.
>>> In der Galerie: die zehn besten Gitarren-Riffs
Es würde einer Untertreibung gleichkommen, wenn man behauptete, dass „The Wall“ unter ungünstigen Umständen entstand. Nicht nur, dass Pink Floyd nach einigen dubiosen Geschäften und den enormen Kosten, die die technisch problematische Produktion des Vorgängeralbums „Animals“ verursacht hatten, praktisch so gut wie pleite waren, die „In-The-Flesh“-Tour steckte Hauptsongwriter Roger Waters immer noch in den Knochen. Ein halbes Jahr lang hatte die Band Stadien der Welt bereist, um Abend für Abend vor einem regelrechten Meer von Fans aufzutreten und doch fühlte sich der Bassist zunehmend alleingelassen, emotionslos und vermochte keine rechte Verbindung zu dem lauten, rufenden, pfeifenden Publikum herzustellen. All das gipfelte schließlich in einem Ereignis am 06. Juli 1977, das retrospektiv durchaus als eine der Initialzündungen für die Entstehung von „The Wall“ gesehen werden kann. Waters, dem bei dem Gig im Olympiastadion in Montreal ein pöbelnder und grölender Fan negativ aufgefallen war, rief den offenkundig betrunkenen Mann an die Bühne heran, nur um ihm direkt ins Gesicht zu spucken.
Die Selbstzweifel, mit denen Waters sich anschließend auseinandersetzte, verarbeitete er schließlich in dem größten, vielleicht aber auch prätentiösesten Projekt seiner Karriere und Pink Floyds Diskografie: „The Wall“. Die grundliegende Idee eines Rockstars namens Pink, der zwischen sich und seinem Publikum, seiner Familie, seiner Freundin – ach, eigentlich allen Personen seines sozialen Umfelds – eine Mauer errichtete, mag zunächst wie eine platte, oberflächliche Idee klingen. Aber angereichert mit Waters‘ durchaus autobiografischen Zügen, wie ein im Krieg gefallener Vater, den Pink früh verlor, egomanischen Eskapaden oder Drogentrips (mitunter auch inspiriert von der tragischen Geschichte des verrückt gewordenen Wunderkinds und Pink-Floyd-Gründers Syd Barrett), wurde daraus ein Kaleidoskop von Ideen, die der Verzweiflung des Bassisten einen kreativen wie emotional nachvollziehbaren Rahmen verlieh.
Musikalisch hatte sich das Kaleidoskop allerdings von den in allen Regenbogenfarben schillernden, psychedelischen Sounds von „Meddle“, „The Dark Side Of The Moon“ oder „Wish You Were Here“ zu einer kargen Klanglandschaft in Schwarz-Grau-Weiß entwickelt. Das Material, zu 95% von Waters im eigenen Heimstudio in Demoform vorproduziert, entstand spür- und hörbar unter Einfluss von Punk und Disco und bei den anschließenden Studiobesuchen in London, Frankreich und Amerika wurde die eigentliche Bandzusammenarbeit erst gar nicht begonnen. Sowohl Schlagzeuger Nick Mason als auch Richard Wright, die sich später beide negativ zu „The Wall“ äußerten, tauchen in den Credits nirgends auf; Wright, seit Bandgründung der Mann an den Tasten, wurde gar wegen mangelnden Enthusiasmus‘ aus der Band geworfen, nur um bei den gigantischen Konzerten zu „The Wall“ wieder als bezahlter Tourmusiker angestellt zu werden.
Spröde und unnahbar, verstörte das ungewohnte Klangbild des Doppelalbums ein paar Anhänger und Fans, verhalf der Band jedoch zu einem überraschenden Single-Erfolg. Der von Chic inspirierte Discostampfer „Another Brick In The Wall (Part 2)“, mit einem aufmüpfigen Kinderchor, der den teacher dazu auffordert, die kids alleine zu lassen, stürmte die Charts und beendete als letzte Nummer Eins das Jahrzehnt der Siebziger. Keine besonders schlechte Leistung für Pink Floyd, die seit 1968 keine wirkliche Single mehr auf den Markt gebracht hatten und sich vormals als Albumband verstanden. Einen ähnlichen Tenor treffen auch weitere große Teile der Platte: die Hard-Rock-Verschnitte „In The Flesh“ und „Young Lust“, das kühle, beinahe steril wirkende Synth-Stück „Don’t Leave Me Now“, das abgehetzt-paranoide „Run Like Hell“ mit kunstvoller Echo-Gitarrenarbeit von David Gilmour – Gift, Galle und Rotz anstatt Melodieseligkeit.
Ein erhebender, beinahe lichter Moment in all der Finsternis findet sich schließlich im Abschluss der dritten Plattenseite. Auf „Comfortably Numb“ fungierten Roger Waters und David Gilmour wohl das allerletzte Mal als Einheit zusammen und kreierten eine der besten und größten Kompositionen des ganzen Pink-Floyd-Oeuvres. Die Mischung aus Waters‘ simplen Strophen und Gilmours anspruchsvollen, leicht ungewöhnlichen Akkordwendungen im Refrain, gepaart mit zwei der gefühlvollsten Gitarrensoli aller Zeiten, machte den Song zu einem herausragenden Moment auf „The Wall“. Offene und hörfreudige Ohren finden allerdings zuhauf musikalische Kleinode, die gefühlvoll durchaus abseits des Gesamtkonzepts funktionieren. So scheint es heutzutage unmöglich, die sanfte Pianoballade „Nobody Home“ nicht als Hommage an den damals frisch ausgeschiedenen Wright zu verstehen. „I’ve got nicotine stains on my fingers / I’ve got a silver spoon on a chain / I’ve got a grand piano to prop up my mortal remains“, haucht Waters dort ins Mikrofon. Die Outsider-Ballade „Hey You“, mit der die zweite Hälfte des Albums beginnt, überzeugt ebenfalls mit verträumtem Beginn (Fretless-Bass-Solo!) und einem regelrecht (alp-)traumhaften Zwischenteil.
Auf die eine oder andere Weise ist „The Wall“ ein Werk, das einen nicht kalt lässt, oder vielmehr nicht kalt lassen kann. Man mag von dem aufgeblasenen, abgehobenen Konzept abgestoßen werden oder mit den kleinen, unauffälligen Versatzstücken und -stückchen (auch gerne als Füllmaterial bezeichnet) „Vera“, „Stop“ oder „Bring The Boys Back Home“ nichts anfangen können. Nicht zuletzt scheiden sich an dem teilweise etwas spätpubertär wirkenden Konzept die Geister. Und die pure Diskrepanz der Idee, die Entfremdung eines Künstlers zu seinem Publikum mithilfe einer riesigen, aufgeblasenen Produktion (sowohl als Doppelalbum und Live“inszenierung“, wie auch als Film) zu thematisieren, konnte bis zum heutigen Tag auch niemand sinnvoll erklären, am allerwenigsten Waters selbst. Dennoch besitzt die Verzweiflung, die die 80 Minuten lange Musik ziemlich stringent und beinahe unbarmherzig durchzieht, eine Art Sog, der bis heute fasziniert. Generation für Generation entdeckt mit „The Wall“ vielleicht nicht unbedingt das beste Album der Diskografie von Pink Floyd, aber ein unvergleichliches Hörerlebnis für sich, das dafür sorgt, dass „The Wall“ mit mehr als 30 Millionen verkaufter Exemplare als meistverkauftes Doppelalbum weltweit gilt.
Mit den Livekonzerten, die Pink Floyd aufgrund der technischen Komplexität in nur vier Städten aufführten (Dortmund, London, New York und Los Angeles) und bei denen überlebensgroße, aufblasbare Puppen von furchterregendem Aussehen zum Einsatz kamen, sowie der 1982 entstandenen Verfilmung vom britischen Erfolgsregisseur Alan Parker, mit Bob Geldof in der Hauptrolle, entwickelte sich „The Wall“ endgültig zum Gesamtkunstwerk, das von Waters heuer mit viel Pathos, mitunter jedoch etwas gefühllos abermals auf der Bühne in Szene gesetzt wird. Ebenfalls unvergessen ist die teilweise desaströse Aufführung in Berlin kurz nach dem Fall der Mauer, bei der sich der Ex-Floyd-Bassist Unterstützung von so zweifelhaften Naturen wie Ute Lemper, Bryan Adams oder den Scorpions besorgte und während der die riesige Soundanlage mehrmals ausfiel.
Dass all diese Neuaufführungen und Wiederveröffentlichungen bis dato nichts am Mythos rund um „The Wall“ veränderten, spricht für das Album, das in vielerlei Hinsicht für Veränderungen sorgte. So markierte es nicht nur das Ende der „klassischen“ Pink Floyd, sondern ist heute, 35 Jahre nach der Veröffentlichung, rückblickend als letztes großes Werk der Ära des Progressive Rock zu sehen, als Rock-Oper, die alle künftigen Rock-Opern überflüssig machte.