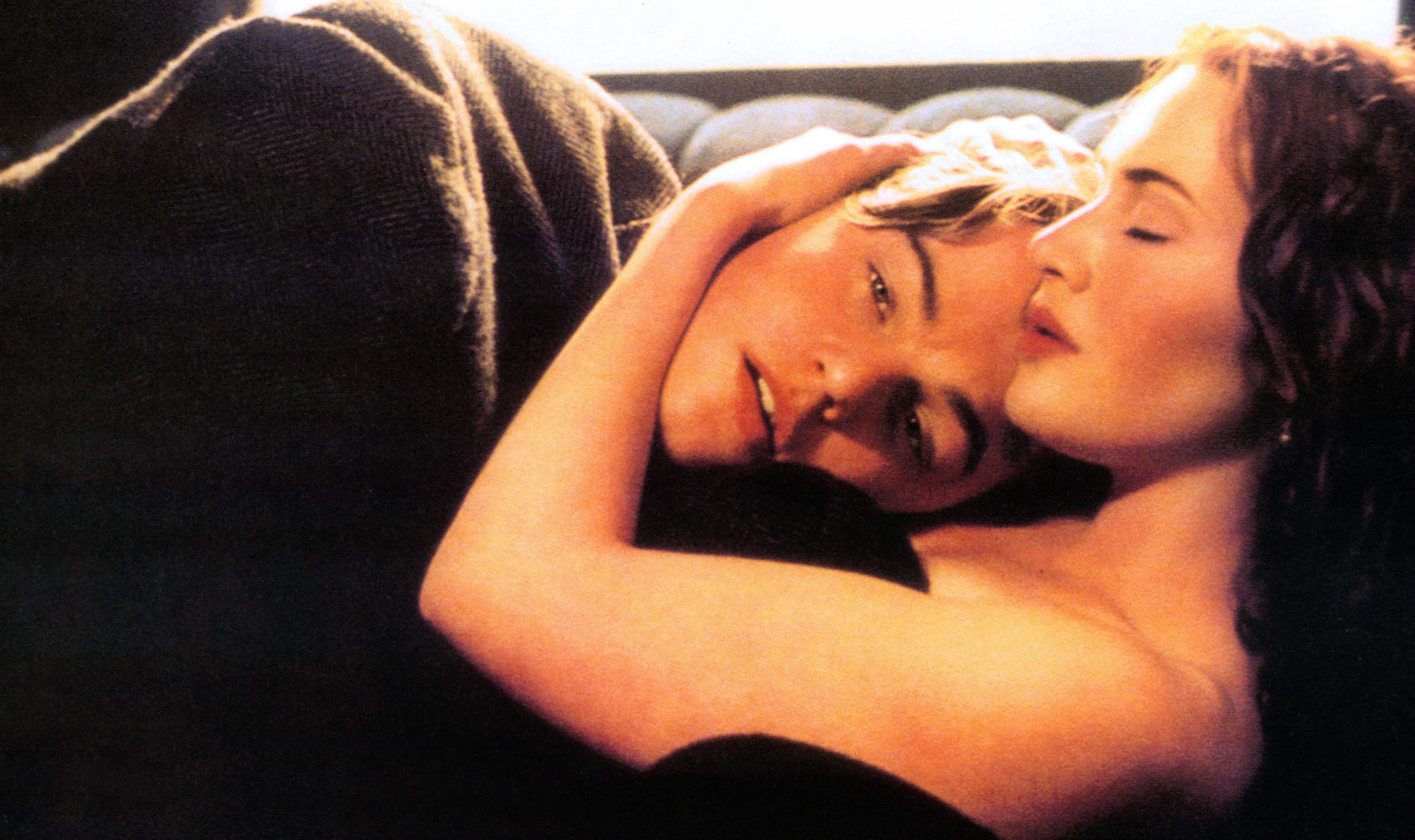Guns N‘ Roses – Chinese Democracy
Alles, was man je gegen Guns N‘ Roses vorbringen konnte, kann jetzt natürlich wieder gegen Axl Rose verwendet werden: Das Album ist zu lang (71 Minuten), die Songs auch. Die schier endlosen Gitarren-Soli klingen wie in den 80er Jahren, die Welt des Sängers dreht sich immer nur um den eigenen Bauchnabel. Kein Vorwurf, den wir nicht schon bei „Use Tour Illusion“ gehört hätten.
Alles Unsinn, wenn man genauer hinhört. „Chinese Democracy“ schließt, und das ist kein kleines Wunder, nahtlos an die guten alten Zeiten an. Was freilich bedeutet, dass sich Rose keine neuen Freunde machen wird und man im direkten Vergleich weiterhin Slash, Duff und eben Guns N‘ Roses vermissen wird. Leihmusiker, die Bumblefoot oder Buckethead heißen, sind dafür kein Ersatz. Ein Vorurteil allerdings entkräftet Rose: Für einen angeblichen Soziopathen und Egomanen zählt er im Booklet verdammt viele Helfer auf. Jedes einzelne Instrument wird aufgeführt, jedes Arrangement gewürdigt, jede noch so kleine Idee vermerkt, jeder darf jedem danken.
Trotzdem ist dies natürlich das Werk eines Einzelnen – einer gequälten Kreatur. Nach 17 langen Jahren erscheint nun doch noch dieses Album, und der erste Satz, den Axl Rose singt, heißt: „It don’t really matter.“ Kurz darauf: „1 know that I’m a classic case/ Watch my disenchanted face.“ Rose mag nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben, er hat sich längst eine eigene erschaffen. Und die breitet sich auf „Chinese Democracy“ aus wie ein funkelnder Teppich aus Nägeln.
Der Anfang ist noch eher mühsam — der Titelsong und „Shackler’s Revenge“ kommen nicht in die Gänge, versinken in recht sinnlosem Lärm. Aber dann. Es folgen die klassischen Rose-Themen: Einsamkeit („Better“), verlorene Liebe („Street Of Dreams“), Vergänglichkeit („If The World“). Seine Stimme hat nichts von ihrer meckernden, greinenden, verzweifelten Kraft verloren. Die Melodien bemühen sich, da mitzukommen. Meistens gelingt es ihnen; nur manchmal geht es so verworren zu, dass man die vielen Jahre im Studio zu spüren scheint. Dann treffen zu viele Entwürfe aufeinander und nehmen sich gegenseitig die Luft zum Atmen.
Doch nicht nur waidwunde Liebeslieder kann Rose noch, auch klassische Rock-Stücke wie das resignativ dröhnende „There Was A Time“, das boshafte „I.R.S.“ und selbst das überfrachtete „Madagascar“ blasen jeden Zweifel weg. Wenn Metallica jemals so viel Verletzlichkeit zeigen würden oder AC/DC so viel Mut. Gemessen an diesen anderen beiden großen Rock-Alben des Jahres, kommt einem der Befreiungsschlag namens „Chinese Democracy“ auf einmal richtig menschlich vor, weil man hier immer einen Menschen hört und nie bloß einen musikalischen Handwerker.
Und ganz am Ende beantwortet Axl Rose vielleicht auch noch die Frage, warum er diese Songs nicht viel früher rausgerückt hat, sondern sich jahrelang verweigerte: „Ask yourself/ Why I would choose/ To prostitute myself/ To live with fortune and shame?“