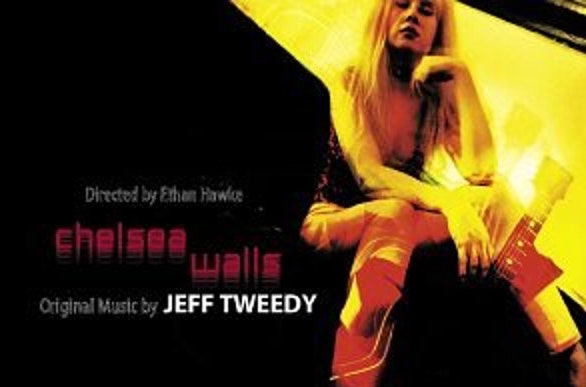Boyhood Patricia Arquette, Ethan Hawke **** :: Regie: Richard Linklater/Start: 5.6.
Zwölf Jahre können sich im Kino wie eine halbe Ewigkeit anfühlen. Ein Regisseur hat die Möglichkeit, die Monate und Jahre durch einen Schnitt zum Verschwinden zu bringen. Gewöhnlich macht ein Texteinschub auf die verlorenen Jahre aufmerksam und kittet damit den Riss in der Zeit. Das Kino ist aber auch ein Ort, an dem man der Zeit beim Verstreichen zusehen kann. Das hat der Film anderen Kunstformen voraus. Das soziale Gefüge, das dieser Prozess offenlegt, wird zum Ausgangspunkt für eine Geschichte, eine Handlung, einen Plot. Das Prinzip ist einleuchtend, jeder Film mit einem gesteigerten Wirklichkeitsanspruch funktioniert auf diese Weise.
Zwölf Jahre – das ist der Zeitraum, über den Richard Linklater seinen neuen Film „Boyhood“ erzählt. Am Anfang sieht man den sechsjährigen Mason auf einer Wiese liegen, während auf der Tonspur „Yellow“ von Coldplay zu hören ist. Zwölf Jahre später läuft im Radio „Get Lucky“ und Mason trägt eine violette Robe, die an amerikanischen Highschools (vielleicht auch nur in Texas, wo die Schüler morgens nach „The Star-Spangled Banner“ noch die texanische Hymne anstimmen müssen) zur Abschluss-Zeremonie gehört. „Boyhood“ endet also konsequent mit dem im Titel bezeichneten Lebensabschnitt.
Das Besondere an „Boyhood“ ist, dass der junge und der alte Mason – so wie in François Truffauts Antoine-Doinel-Zyklus – von demselben Schauspieler (Ellar Coltrane) gespielt werden. In der Ära des digitalen Kinos erscheint das zunächst nicht als bahnbrechende Leistung, doch der einzige Spezialeffekt, der im Film zur Anwendung kommt, ist gewissermaßen der Rohstoff jeder Kino-Erzählung: Zeit. Auch Masons Vater Mason Sr. (Ethan Hawke), seine Mutter Olivia (Patricia Arquette) und Schwester Samantha (Linklaters Tochter Lorelei) werden über zwölf Jahre von denselben Darstellern gespielt. Wenn es denn so etwas wie einen Spezialeffekt in „Boyhood“ gibt, kann man ihn am besten an der großartigen Patricia Arquette beobachten, die während der Dreharbeiten selbst Mutter wurde, und in deren Körper sich die Zeit auf wunderbar uneitle Weise einschreibt. „Motherhood“ wäre als Titel also mindestens ebenso angemessen, weil die Adoleszenz, die Mason in „Boyhood“ durchläuft, eben auch für Mütter eine Kraftanstrengung bedeutet – zumal, wenn sie mehr oder weniger alleinerziehend sind wie Olivia. Linklater weiß das zu würdigen. Am Ende, als das zweite Kind endlich aus dem Haus ist, erfährt Arquettes unverwüstliche Olivia eine emphatische Huldigung, die mit einem gewagten Verfremdungseffekt so dermaßen konsequent jeden Verdacht von Kitsch und Pathos ausräumt, dass man sich kurz in einem seltenen Avantgarde-Moment des amerikanischen Mainstreamkinos wähnt. Mutter ist die Beste, auch das ist nach 165 Minuten ein Fazit von „Boyhood“.
Mit seiner unwahrscheinlichen Produktionsgeschichte ist „Boyhood“ eine Ausnahmeerscheinung im amerikanischen Kino. Linklater hat in vielen Filmen seine Figuren beim Älterwerden beobachtet. Seine romantische „Before“-Trilogie mit Ethan Hawke und Julie Delpy war ursprünglich nicht als solche angelegt, sie ging aus einem Arbeitsprozess und Linklaters Interesse an biografischen Verläufen hervor. „Boyhood“, der parallel zu „Before Sunset“ und „Before Midnight“ entstand, geht noch einen Schritt weiter als die derzeit so populären Prinzipien „Sequel“ und „Serielles Erzählen“. Die Langzeitbeobachtung ist ursprünglich eine Methode des Dokumentarfilms. Linklater interessiert an diesem Verfahren jedoch primär der kreative Prozess: die Wechselwirkung von Biografie und Fiktion, Darsteller und Charakter. „Boyhood“ ist ein offenes, organisches Projekt. Eine, wenn man so will, fiktionalisierte, interaktive Langzeitstudie.
Wie natürlich Coltrane sich im Laufe der Jahre die Rolle Masons anverwandelt, ist das Erstaunliche an Linklaters Methode. In seinen formativen Teenager-Jahren spielte er eine Figur, die Teil seiner eigenen Sozialisation wird. Dieser realistische Effekt schlägt sich in „Boyhood“ auf vielen Ebenen nieder, in den popkulturellen Referenzen aber auch im Umgang der Darsteller miteinander, die jedes Jahr für nur wenige Tage zusammenkamen. Geschnitten hat Linklater seinen Film chronologisch, unmittelbar im Anschluss an die Dreharbeiten. Somit wird „Boyhood“ zu einer permanenten Momentaufnahme, und ist gleichzeitig eine Familienchronik ohne autoritäre Erzählerstimme. Die Jahre fließen nahtlos ineinander, kenntlich gemacht lediglich durch wechselnde Wohnorte, die Konstellation der Patchworkfamilie und die Frisuren. Die logistische Herausforderung, die „Boyhood“ darstellt, ist die eine Meisterleistung Linklaters. Die andere besteht darin, wie selbstverständlich er die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Spiel auflöst.
Die zwei Gesichter des Januar Viggo Mortensen, Oscar Isaac ***v
Regie: Hossein Amini/Start: 29.5.
Lange bevor man weiß, dass Hossein Aminis Edelkrimi „Die zwei Gesichter des Januar“ ein Roman von Patricia Highsmith zugrunde liegt, ist man gefühlsmäßig schon im italienischen Laisser-faire der 60er-Jahre: Alain Delon und Maurice Ronet, stark gebräunt und in weiße Leinenhosen gesteckt. Delon, halbnackt am Steuerrad der Yacht „Marge“. Ronet, müde lächelnd am makellosen Hintern von Frau Marge. Zwei Männer, so schön wie abgründig. René Clément hat beide 1960 in „Nur die Sonne war Zeuge“ sehr ansehnlich ins Bild gesetzt. Und Delon und Ronet, alias Tom Ripley und Philippe Greenleaf, stammen ebenso aus der Feder von Autorin Highsmith wie Chester MacFarland (Viggo Mortensen) und Rydal Keener (Oscar Isaac) in „Die zwei Gesichter des Januar“. Figuren, die durch scheinbar magnetisch wirkende Kräfte zueinander finden, sich gegenseitig ablehnen und doch bedingen. Im Spannungsfeld jener Schönlinge auch dieses Mal: eine Lady. Ehefrau Colette MacFarland, sublim verkörpert von Kirsten Dunst. Nun formiert sich das Dreieck nicht in Ligurien, sondern in Athen, 1962. Hier arbeitet Rydal Keener als Stadtführer, der Touristinnen auch gerne um ein paar Münzen erleichtert. Das Paar MacFarland beobachtet ihn dabei -und Keener wiederum ist wie elektrisiert von den wohlhabenden amerikanischen Eheleuten. Natürlich wird ein Kriminalfall sie zusammenführen. Und natürlich spielt Colette eine Rolle in dem empfindlichen Konstrukt. Es ist dieser Tanz entlang des Abgrunds, der „Die zwei Gesichter des Januar“ zu einem besonderen Film macht. Wenn sich Regisseur Amini viele Minuten Zeit lässt, Chester MacFarland in seiner mondänen Zerupftheit zu präsentieren, ihn pausenlos filterlose Zigaretten paffen, Ouzo und Kaffee in sich hineinschütten lässt, um anschließend ein wunderbar öliges Profil im Abendlicht zu notieren, dann ist das vielleicht manieriert, aber auch ziemlich großartig. CAROLIN WEIDNER