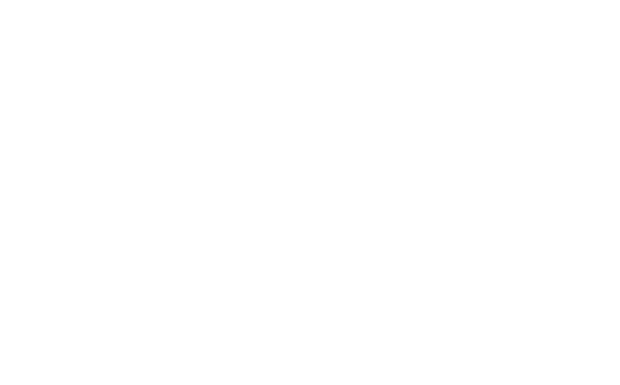Der Getriebene – zum Tod des großen Schauspielers Philip Seymour Hoffman
Erst im Nachhinein, als sich schon die Zeitschriften für ihn interessierten und er der König der schwierigsten Nebenrollen war, merkte der Kinogänger, dass er Philip Seymour Hoffman längst kannte
Man hatte ihn 1992 übersehen in „Der Schein-Heilige“, einer ebenso überdrehten wie sentimentalen Komödie mit Steve Martin, nicht bemerkt als Assistent von Al Pacino in „Der Duft der Frauen“ im selben Jahr und als Polizist im Winter in „Nobody‘s Fool“ (1994) neben Paul Newman. Nun erkannte man ihn, vielleicht an einem müden Fernsehabend, in dem Katastrophenfilm „Twister“ von 1996. Und natürlich – das unglückliche Faktotum in Burt Reynolds‘ mittelständischem Porno-Betrieb in „Boogie Nights“ war auch Hoffman. Und in „The Big Lebowski“ spielte er wieder einen etwas seltsamen Domestiken am Rande. In Todd Solondz‘ „Happiness“ (1998) hatte er dann eine unheimliche Präsenz als ekliger anonymer Anrufer, der Schreckliches anrichtet: ein Monster, das zum wimmernden Häuflein Selbstmitleid wird. Mehr als 20 Filme hatte Hoffman gedreht, als die große Karriere begann.
Am 23. Juli 1967 wurde Philip Seymour Hoffman in Fairport, Rochester im nördlichen New York geboren, und an der Tisch School For The Arts an der New York University wurde er ausgebildet. Er gehörte zu den Gründern der „LAByrinth Theater Company“ und spielte in O‘Neills „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ und Shakespeares „Othello“, in Tschechows „Möwe“ und Sam Shepards „True West“ – alles Teil einer soliden amerikanischen Theater-Ausbildung, aber auch von gestalterischen Ambitionen, aus der Karrieren wie die von Willem Dafoe oder William H. Macy hervorgingen. In „Die Geschwister Savage“ sieht man ein wenig von den Härten des Off-Theaters, und als Kritiker ist Hoffman da gnadenlos. Er hatte die Mittel dazu, Hollywood-Stars an die Wand zu spielen – stattdessen illuminierte er eher ihre Darstellungen: Seine kleine Rolle in Anthony Minghellas „Der talentierte Mr. Ripley“ konterkariert den gefährlichen Frohsinn von Jude Law und die Blässe von Matt Damon; in „Magnolia“ unterstreicht er (wieder als Pfleger) die Leistung von Jason Robards, in „Makellos“ hat er die dankbarere Rolle, stiehlt Robert de Niro aber nicht alle Szenen – und in „Mission: Impossible III“ (2006) ist sein Schurke zwar sehr cool, aber Hoffman versucht nicht, Tom Cruise in dessen Vehikel die Schau zu stehlen.
Sehr eindrucksvoll sah man zuletzt in dem wunderbaren Film „Saiten des Lebens“, wie Hoffman im Wortsinn die zweite Geige neben Christopher Walken spielt und daran beinahe zugrunde geht. Vielleicht ist es nur Einbildung – aber die Brutalität, mit der Robert Gelbart sein Leben wegwirft, weil er eben nicht bloß der beste Begleiter sein will, hat vielleicht doch mit der Radikalität und Uferlosigkeit des Menschen Philip Seymour Hoffman zu tun. Noch gespenstischer ist das Zusammenspiel von Leben und Film bei „Before The Devil Knows Your’re Dead“, Sidney Lumets raffiniertem Psycho-Krimi von 2007: Der unauffällige, vermeintlich souveräne Andy Hanson, gespielt von Hoffman, klingelt an einer Wohnungstür, tritt ein und lässt sich in einem Zimmer eine Infusion mit Heroin geben, sozusagen in der Mittagspause.
Im Jahr 2003 spielte Hoffman noch einmal bei Anthony Minghella in dem berückend elegischen „Cold Mountain“ und bekam hernach die erste Hauptrolle in dem kleinen Film „Owning Mahowny“ als Spielsüchtiger, der auch noch den letzten Cent in seine Sucht investiert, Geld unterschlägt und dann vor den Geschädigten fliehen muss: ein Kleinbürger als zitternde Heimsuchung, die das große Spiel durcheinanderbringt. Ein halbes Jahr bereitete Hoffman sich dann auf die Rolle des Truman Capote vor, verlor Gewicht und trainierte sich die notorische Fistelstimme des Autors an. Der Oscar für „Capote“ (2006) war einer mit Ansage. Für andere Schauspieler wäre es schwer gewesen, wieder in die zweite Reihe zurückzutreten, doch Hoffman gab jetzt seine reichsten Darstellungen: den schlunzigen CIA-Mann in Mike Nichols‘ „Der Krieg des Charlie Wilson“ (2007), den Brecht-Spezialisten in „Die Geschwister Savage“ (2007), den Priester in „Glaubensfrage“ (2008), den politischen Berater in „Tage des Verrats“ (2011), der am Ende in die Wüste geschickt wird. Dazwischen drehte er seinen eigenen, sehr anrührenden Film, „Jack Goes Boating“, der in Deutschland leider zu „Jack In Love“ umgetauft wurde. Auch in dem Baseball-Film „Moneyball“, einem Brad-Pitt-Schauspiel, lieferte Hoffman eine frappierende Vignette als maulender Trainer, der nicht weichen will. „The Master“ war sein vierter Film mit Paul Thomas Anderson nach „Boogie Nights“, „Magnolia“ und „Punch-Drunk Love“. So blieben der beste Regisseur dieser Generation und ihr bester Schauspieler zusammen.
Philip Seymour Hoffman war seit 2003 verheiratet und hatte drei Kinder. Er bekannte offen, dass er als junger Mann drogensüchtig war und im Jahr 2012 wieder zu Medikamanten griff und Heroin schnupfte, woraufhin er sich in eine Entziehungsklinik einweisen ließ. Doch danach ging es weiter: Dreharbeiten. In mehr als 50 Filmen trat Hoffman insgesamt auf, und die beiden nächsten waren schon geplant, auch ein Regie-Projekt mit Jake Gyllenhaal.
Man kann nicht in das Herz eines Menschen blicken, und es ist wohlfeil zu sagen, dass niemand diesen Mann gekannt hat. Hoffman hat sich kaum je verkleidet, und er war nicht das „Chamäleon“, von dem oft geschrieben wird. Seine uneitle Kunst lag darin, uns in jeder Inkarnation die Würde von mühseligen und beladenen, verliebten und verzweifelten, schüchternen und mutigen Männern zu vermitteln, Männern, die zagen und scheitern und irren, die am falschen Ort sind, im falschen Körper oder im falschen Leben. Es gab bei ihm keine falschen Gesten, nichts Theatralisches, und er spielte das Traurige und das Peinliche als alltäglichen Schrecken. Oft haben seine Figuren ein Phlegma, das über ihre Getriebenheit und ihre Dämonen hinwegtäuscht. Als er in „Saiten des Lebens“ verletzt ist, lässt er sich von einer Bewunderin trösten, und am nächsten Tag findet ihn seine Frau in der Shopping Mall und kündigt die Ehe auf. Nachdem sie weg ist, nimmt Hoffman langsam seine Jacke und geht. Die Tragödie vollzieht sich ganz und gar im Inneren.
In der Nacht zum 2. Februar starb Philip Seymour Hoffman in seiner Wohnung in Manhattan an einer Überdosis Heroin, 46 Jahre alt. Dafür gibt es keinen Trost.