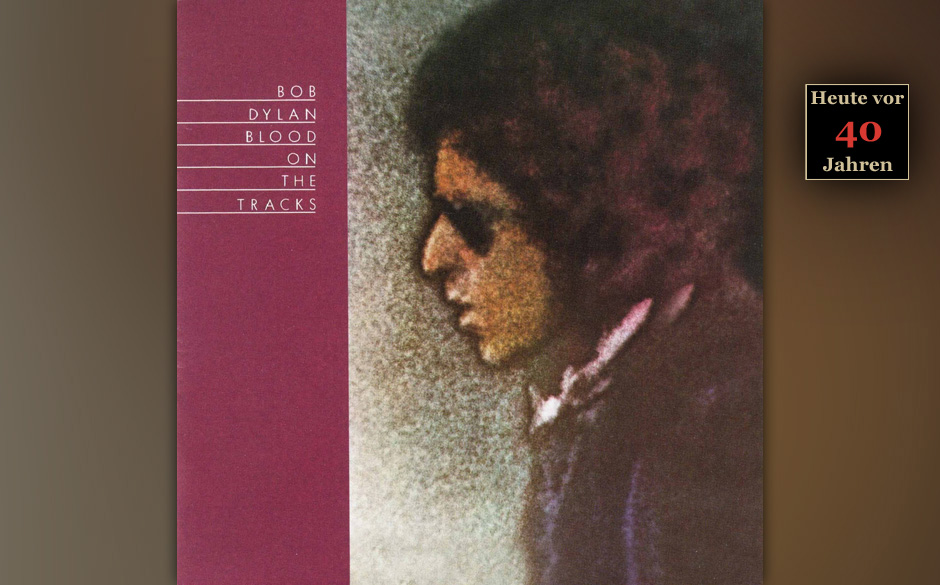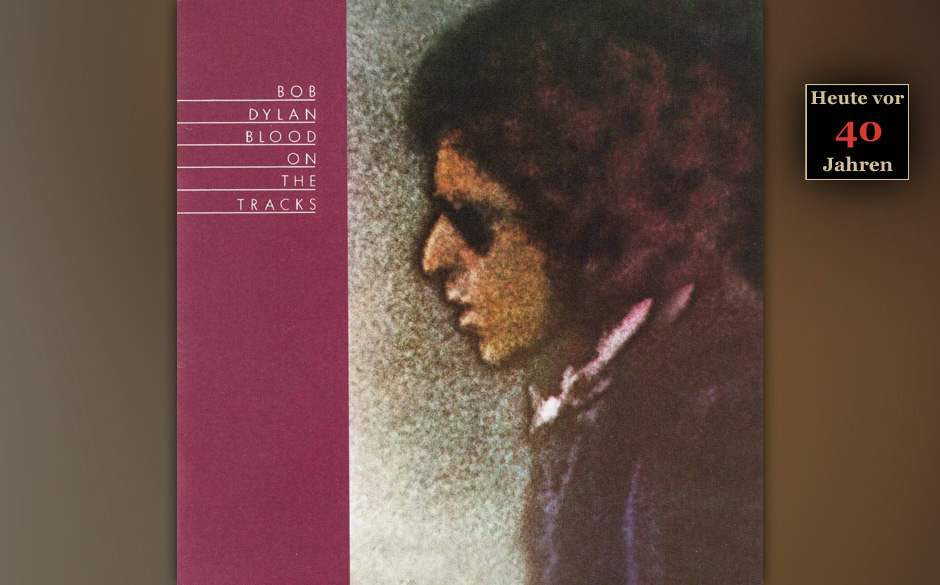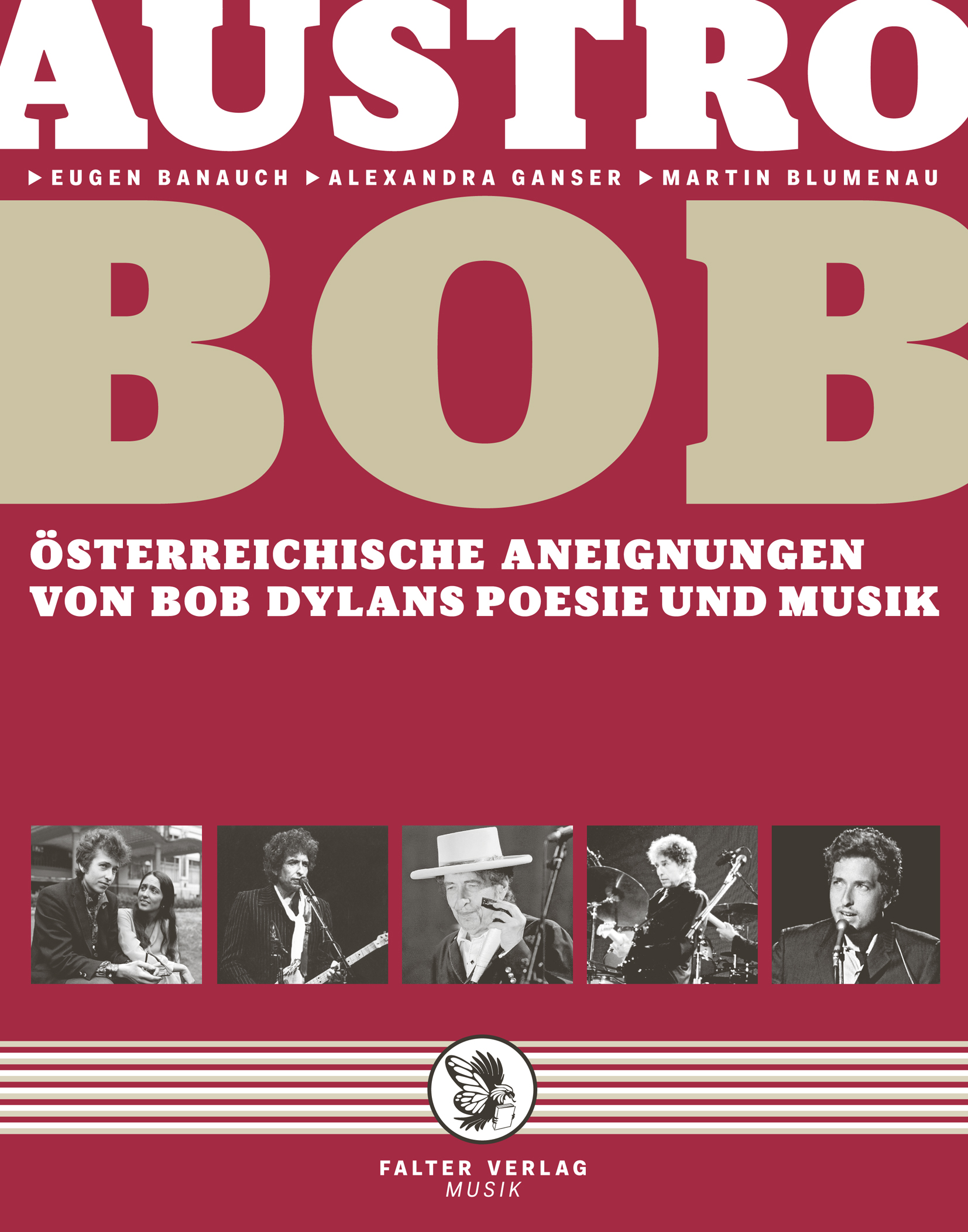40 Jahre ‚Blood On The Tracks‘ von Bob Dylan: „Wir sind Idioten, Babe“
Markus Brandstetter über "Blood On The Tracks", das bedeutendste Trennungsalbum der Geschichte.

Wir sind Idioten, Babe
Es gab nichts, was mich an „Idiot Wind“ nicht begeistert, beinahe umgeworfen hätte, als ich den Song zum ersten Mal hörte. „Idiot Wind“ sprach mich nicht nur auf jeglicher erdenklichen Ebene an, es schrie mir regelrecht ins Gesicht, klopfte mir auf die Schulter, spuckte mir vor die Füße, erzählte mir eine Geschichte, schlug mir in die Magengrube, stellte mir von hinten ein Bein und brachte mich zum Lachen. Mit Katharsis (ohnehin so ein überstrapazierter Begriff) hatte das alles nichts zu tun: Bei „Idiot Wind“ steigt niemand glücklicher, leichter oder mit neuen Erkenntnissen aus dem Boxring. „Idiot Wind“ ist wütend und unbesonnen, traurig und unversöhnlich, ausschweifend und selbstmitleidig, bitter und selbstgerecht, kaputt und doch trotz allem schlussendlich irgendwie auch zärtlich. Hier steht jemand mit geballten Fäusten und Schaum vor dem Mund am Grab und fordert zum Kampf heraus. Ich wusste damals nicht, dass Blood on the Tracks (eben das Album, auf dem der Song enthalten ist) angeblich von der Trennung von seiner ehemaligen Ehefrau Sara handelte, es wäre mir auch nicht wichtig gewesen, das zu wissen. Was wichtig war: Da holt mich jemand mit ein paar der wunderbarsten, melancholischsten Stücken über zerbrochene Liebe und Trennungen ab, die ich vielleicht je gehört hatte, und wenige Songs, nachdem die Lovers noch händchenhaltend durch den Park schlenderten, schleudert er mir diesen Moloch von einem Song entgegen. Zieht die Silben lang (meine Lieblings-Gesangsphase bei Dylan), spuckt Galle. Wirft der Verflossenen alles Erdenkliche vor, ist völlig uncharmant, vergibt und vergisst nichts, klammert aber sich selbst am Ende nicht aus. Unfassbar tolle Strophen, bestehend aus Anklagen, Beleidigungen, Enttäuschungen und ein paar schönen Metaphern, ehe Dylan, oder wer auch immer der Erzähler im Song ist, am Ende des letzten Verses dann doch sagt, wie leid ihm das alles tut. Da hatte jemand gelitten, und zwar so richtig, nimmt das aber nicht als gegeben hin, sondern reißt die alten Wunden noch einmal mit aller Kraft auf – und statt Desinfektionsmittel gibt es ordentlich Salz.
Ich war damals gerade volljährig, meine erste längere Beziehung war eben in die Brüche gegangen, da kam mir ein derartiger Song entgegen. In diesem Spätsommer fuhr ich mit dem Auto meiner Eltern gerne und oft ziellos die Klagenfurter Seeumfahrungsstraße auf und ab – zu all den kleinen, ab Herbst ausgestorbenen Ortschaften (und der Herbst war bereits deutlich spürbar). „Blood on the Tracks“ lief dabei immer auf voller Lautstärke, und ich zog gemeinsam mit Bob die Vokale und Textzeilen in die Länge. Fast so, wie ich mir im Alter von zwölf, dreizehn Jahren noch zu Zwecken der Psychohygiene zu Alben von Metalbands wie Sepultura oder Pantera die Stimmbänder heiser brüllte. Von wegen Elvis hätte den Körper befreit und Dylan nur den Geist: „Idiot Wind“ fuhr mir wie ein freight train durch alle Organe und zwang mich bei jedem Hören in die Knie. Außerdem dachte das Stück nicht daran, irgendetwas befreien zu wollen, und ganz bestimmt gaukelte es nichts vor: Keine Antworten, keine Lösungen und ganz sicher keine happy endings. Das imponierte mir und gab mir am Ende doch wieder ein komisches, aber herrliches Gefühl von Trost. Abgekürzt: „Idiot Wind“ traf mich auf vielen Ebenen gleichzeitig, genauso wie das viele von Dylans Stücken auf ganz verschiedene Arten taten – und das immer noch tun.
Ich hatte mich auch vor dieser Zeit mit Dylan schon ein wenig beschäftigt, mir mein erstes Album im Alter von neun Jahren gekauft. Unglücklicherweise war das allerdings das für mich etwas schrullig klingende Good As I Been To You (also wohl genau das falsche Einsteigeralbum für einen Neunjährigen), und so verlor ich dann nach drei, vier Songs sofort das Interesse. Mit fünfzehn fand ich über eine Best-of-Compilation doch noch recht jung einen Zugang zum Kosmos des Song-and-Dance-Man und konnte mich somit die nächsten Jahre querarbeiten. „Idiot Wind“ war also nicht der ausschlaggebende Moment, mich mit dem Kosmos Dylan zu beschäftigen, aber wohl einer der essenziellsten. So sehr ich mich Dylan im weiteren Verlauf meines Lebens aber auch von anderen Blickwinkeln anzunähern versucht habe: Für mich geht es immer um diese „Idiot Wind“-Momente, diese folgenschweren Kollisionen mit Songs – eben das, was das Leben so lebenswert und Songs so hörenswert macht. Alles andere ist Beiwerk.
Keine Frage, ich liebe auch die Mythologien, das Seemannsgarn, das Biografische bei Dylan – all das kommt bei näherer Beschäftigung mit seinem Schaffen wohl automatisch dazu. Die großen Geschichten und Geister der Vergangenheit, die offenen Fragen, die lakonischen Aphorismen, die er der Presse vor allem als junger Mann gerne entgegenschleuderte. Die Beschäftigung mit Dylans Songwriting, mit Motiven, roten Fäden, Interpretationen. Die Essenz meiner Beziehung zu Bob aber zeigt sich, wenn die Mythen und biografischen Fakten und Interpretationen, das ganze Meta-Brimborium, in den Hintergrund treten und auf einmal dieser Song da ist, der einen einnimmt. Und die Erinnerung daran, wie es war, als ich diese Songs zum ersten Mal hörte, als ich zum ersten Mal dieses trockene „How Does It Feel?“ entgegengeschleudert bekam, und dieses langgezogene „Didn’t you?“. Songs, die mich ganz gelöst von ihrem zeitlichen, geografischen und kulturellen Entstehungskontext völlig vereinnahmt haben, Teil meiner eigenen Geschichte wurden. Dylan hat viele solcher Stücke geschrieben.
Als Musiker, der auch gerne mal die eine oder andere Akustik- oder Folksession spielt, kommt man schwer darum herum, Dylans Stücke im Repertoire zu haben. Man kann mit ihnen machen, was man will, sie dehnen oder komprimieren, sie ungerade machen, mit Kontexten und Paradigmen, Takten und Harmonien spielen. Man kann beispielsweise „All Along the Watchtower“ auf zig verschiedene Arten spielen, das Stück – immer wieder nur aus a-Moll, G-Dur und F-Dur bestehend – nach Belieben in die Länge ziehen, sich mit Dynamiken geradezu austoben. Man kann ein zwanzigminütiges Jam-Monster mit einer dynamischen Berg-und-Tal-Fahrt und Solisten-Spirenzchen daraus machen, wie das die Dave Matthews Band tat, es funktioniert aber genauso als melancholisches Zeugnis der generellen Verdammnis mit rudimentärer Klavierunterlegung oder als testosterongetränkte Schweinerock-Orgie. Die Reihe lässt sich fortsetzen. Was genau der Joker im Lied zum Dieb sagt, ist bekannt. Aber wie er es sagt, wie der Wind in der letzten Strophe zu heulen beginnt und ob die Aussage des Jokers „No reason to get excited“ beruhigend sein soll, ironisch oder einfach nur ein abgebrühter, müder Fingerzeig auf die ohnehin längst stattfindende Apokalypse: Damit kann (und soll) man sich spielen, und das sind weit mehr als nur Nuancen. All das zeugt von der Grundsubstanz dieser Stücke. Der Terminus „Grundsubstanz“ klingt zugegeben vielleicht ein wenig architektonisch, aber das trifft es im Grunde auch: von Dylan erschaffene Grundumrisse und Gebäude, die einem jede Menge Platz für eigene Vorstellungen von Innenarchitektur lassen (Hendrix’ Vorsprung als Innenarchitekt von „Watchtower“ bleibt uneinholbar), und die auch so schnell nicht einstürzen. Man könnte auch etwas sarkastisch sagen: Stücke, die so gut sind, dass man sie nicht totkriegt. Ob sie allein deswegen gleich unsterblich sind, ist eine andere Frage.
„I just write them because nobody says you can’t write them“, sagte Dylan selbst in einem Interview in den Achtzigerjahren über seine besten Songs. Dieses Trockene, Entmythologisierte, oft ein wenig Sardonische, diese Verweigerung und Ironisierung von angedichteten Rollen, Adelstiteln und messianischen Pflichten: das liebe ich an Dylan als Person. Für eine ganze Generation der unfreiwillige Folk-Heilige des Protestsongs zu sein und sich dann mit der elektrischen Gitarre und Rockband auf die Bühne des Newport Folk Festivals zu stellen und sich ausbuhen zu lassen, weil man jetzt eben Rock ’n’ Roll spielen will: das ist Nonchalance. Auch, den überlebensgroßen Schatten der eigenen Vergangenheit, des eigenen Namens nicht zum Anlass zu nehmen, reiner Nachlassverwalter des eigenen Werks zu werden oder seine Pensionistenjahre beim Kartenspielen in Malibu zu verbringen, sondern durchgehend weiter Musik zu machen, Alben aufzunehmen, zu touren. Auch, wenn das Epizentrum eine Erinnerung vergangener Tage ist.
Nicht falsch verstehen: Ich finde längst nicht alles bemerkenswert, was Dylan über die Jahrzehnte gemacht hat, und um ehrlich zu sein war ich von seinem Wien-Konzert im Juni 2014 auch nicht wirklich begeistert. Ich fand seine Version von „Blowing in the Wind“ an jenem Abend sogar fürchterlich nichtssagend, die meisten Bluesstücke der neuen Alben klangen für mich austauschbar und repetitiv, und wirklich genossen habe ich auch nur eine Handvoll der vorgetragenen Songs. Dass dann ringsum viele Menschen in Ehrfurchtsstarre verharrten, während ich mit dem unsäglichen Dylanologen-Teil in mir haderte, der mir einreden wolle, dass das in Wirklichkeit doch alles ganz großartig ist, tat ein Übriges. Man muss Dylan nicht mit diesem kreuzbraven Respekt begegnen, in allem (jedem Akkord, jedem Reim, jeder Geste und jeder Aussparung) Metaebenen finden wollen und bibeltreu jede noch so gemurmelte Silbe des Meisters für gravierend und herrlich erachten. Ich finde es wundervoll, dass Dylan immer noch neue Alben aufnimmt, tourt, seine Lieder umwirft und neu aufbaut, ich mag seine Crooner-Stimme der letzten Dekade und das Zusammenspiel seiner Band. Auch auf den neueren Alben finde ich immer wieder ein paar Stücke gut. Aber wenn ich mir nicht selbst ins Fäustchen lüge, muss ich auch sagen, dass für mich das wirklich Große, das Dylan geschaffen hat, lange zurückliegt. Für mich selbst sehe ich da keinen Grund, das beschönigen zu wollen, und das tut auch dem keinen Abbruch, was Dylan für mich persönlich war, ist und bleibt: ein großartiger Songschreiber, Musiker und Texter, der eine Vielzahl an Songs geschrieben hat, die aus der Populärkultur und meinem Leben nicht mehr wegzudenken sind und die mich auch Dekaden nach ihrer Entstehung geprägt, aufgerüttelt, begeistert und fasziniert haben, wie wenige andere Lieder und Songschreiber es geschafft haben.
Ich beneide jede und jeden, die oder der es noch vor sich hat, diese Songs für sich zu entdecken, zum ersten Mal „Like a Rolling Stone“, „Visions of Johanna“ und „Desolation Row“ zu hören, „Don’t Think Twice (It’s All Right), „Idiot Wind“ und vieles andere.
Und bei „Idiot Wind“ habe ich noch eine Empfehlung: Zuerst die New-York-Demo des Stückes hören. Die ist traurig, aber irgendwie auch noch verständnisvoll. Dann die Albumversion auf Blood on the Tracks: hier geht es schon deutlich bitterer zur Sache. Und dann zu guter Letzt die Liveversion auf Hard Rain: da versprüht Dylan nur noch reines Gift. „Wir sind solche Idioten, Babe, ein Wunder, dass wir überhaupt noch wissen, wie man atmet“, singt er und klingt dabei doch völlig atemlos. Pure Perfektion, wenn Sie mich fragen.
Das Kapitel ist ein Auszug aus dem Buch „AustroBob“, erschienen im Falter Verlag 2014, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung. „AustroBob“ erzählt von der Resonanz Bob Dylans in der österreichischen Literatur, Musik, Popularkultur, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie in ganz persönlichen Lebensgeschichten.